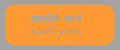 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
Geschichte 4, 6 und 5 |
|||||||
|
4. Kein Bart bei der Volksarmee oder: Rache ist süss und gehört zum Leben Nachdem ich einige Jahre beim Mittelwellensender in Wilsdruff gearbeitet hatte, verfiel man dort darauf, dass man beim Aufbau des Sozialismus nicht nur die Arbeit abzusichern hätte, sondern auch, dass der Sozialismus geschützt werden müsse. Einsatzbereitschaft war das damalige Schlüsselwort. Nun glaubte ich zwar, dass dies nicht unbedingt der Einfall der Leitung am Sender war, sondern sicherlich Vorgaben aus der Parteiebene der SED, die so etwas verlangten. Jedenfalls traf es mich und ich musste als bereits gedienter Soldat meine Reservistenpflicht erfüllen, obwohl ich 1961 zum Ende meines freiwilligen zweijährigen Dienstes ausdrücklich diese Erklärung nicht unterschrieben hatte. Aber man machte mir schell klar, dass jetzt eine Pflicht bestehe, die jedem im Sozialismus lebenden Menschen Bedürfnis sein müsse. Nun, ich hatte kein Bedürfnis, musste aber trotzdem murrend gehen. Damals trug ich ja schon meinen Bart und mir schwante schon einiges, aber ich wollte mich tapfer verteidigen. Bei der pflichtgemässen vorherigen Meldung im zuständigen Wehrkreiskommando wollte man mir die Bartabnahme nahe legen, liess dies aber gleich sein, da ich darauf verwies, dass bei der ruhmreichen Sowjetarmee genügend Bartträger in höheren Posten zu sehen wären, die sicherlich unbestritten vom Sozialismus überzeugt seien. Man sagte mir statt dessen, dass ich alle fachlichen Unterlagen meines Berufes zusammen- kramen solle, weil ich als ehemals beim Panzerfunk dienender Funkmechaniker Unterricht erhalten würde, der weit in das Gebiet des Ingenieurs gehen würde. Und ich sei doch eben nur ein Funktechniker. Mich hat das nicht geschreckt und ich nahm auch nur dürftige Unterlagen mit. Wie Recht ich damit hatte, zeigte sich bei der Vorstellung der eingezogenen Genossen in der Kaserne. Wir waren in die Nachrichtenkompanie in Frankfurt/Oder in Kompaniestärke eingezogen worden und ich war speziell in einem Zug, bei dem der Zugführer auch vom Sender Dresden kam. Allerdings vom Fernsehsender an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei, in Zinnwald an der Nähe vom Hochmoor. Die Genossen stellten sich also vor: Gefreiter, Unteroffizier und weiter Gärtner, Traktorist, Elektriker und so weiter. Da war ich der einzige Interessante bei der Truppe. Ich war einfacher Soldat, im Anwendungsgebiet Truppführer und noch Fachmann. Denn ich hatte zwei Jahre in der Nachrichtenwerkstatt in Dresden Panzerfunkgeräte repariert, hatte mich als Truppführer mit Fahrzeug und Kraftfahrer um defekte Funkstationen gekümmert und sie wieder in Funktion gebracht. Einfacher Soldat war ich nur deshalb, weil ich die zuvor freiwillige Reservistenerklärung nicht unterschrieben hatte und nur deshalb nicht befördert wurde. Der Alltag kam schnell mit Dienst, Ausbildung und Unterricht. Relativ schnell auch der Befehl vom Kompaniechef, den Bart abzurasieren. Was ich natürlich ablehnte. Aber der Kompaniechef war besorgt um die Ausführung und Erläuterung zu diesem Befehl. Dieser war, wurde mir bedeutet, höchstselbst vom Bataillionskommandeur gekommen. Dieser hatte ziemlich konsterniert festgestellt, dass sich unter der angetretenen Kompanie ein Bartträger befand. Argumente zählten nicht, sagte er, es gehe auch gar nicht um den Bart, sondern um die Ausführung eines Befehls, und das sei problematisch, wenn ich den verweigern würde. Meine Argumentation kam von der anderen Seite. Ich nutzte erst das Argument vom Wehrkreiskommando. Begann dann aber über sinnlose und sinnvolle Befehle zur Kampfbereitschaft zu referieren. Mir wurde aber abgesprochen, darüber zu entscheiden, weil ich bei dem jeweiligen Kampfgeschehen nicht entscheiden könne, ob ich einen Befehl nun ausführe oder nicht. Zumal davon im Kriegsfall durchaus das Leben eines ganzen Zuges abhängen könnte und ich das im Augenblick nicht einschätzen könnte. Also sei jeder Befehl rückhaltlos auszuführen. Wenn aber, so meine Gegenargumente, ich in der Hitlerarmee den Befehl bekommen hätte, mit der Zahnbürste die Toilette zu säubern, stehe mir wohl eine Einschätzung zu und in der jetzigen Volksarmee würde ich sehr wohl den Befehl mit den Hinweis auf vergangenes Nazitum verweigern. Und so viel Bewusstsein als Genosse Soldat hätte ich wohl, das unterscheiden zu können. Zur Erläuterung sei erwähnt, dass bei der Nationalen Volksarmee der DDR jeder Soldat mit Genosse angesprochen wurde, auch wenn er nicht in der Partei war. Und ich war nicht. Knapp drei Tage liess man mich gewähren. In den anderen Zügen wurden schon Wetten auf meine Standfestigkeit abgeschlossen und ich erhielt anonyme Anrufe, ja durchzuhalten. Auf dem Kasernenhof brüllte mich unterdessen auch mal ein unbekannter Offizier an, sofort den Befehl auszuführen. Meine Antwort weiss ich nicht mehr, aber er sauste wutentbrannt und höchst erregt davon. Doch jetzt begann der Kompaniechef klug mit einer neuen Taktik. Er sagte mir, dass ich mit meiner Ansicht nicht durchkommen und sie mich einsperren würden. Er sagte nicht “ich”, er sagte “sie” und es war klar, das Thema lag auf der oberen Bataillionsebene. Und die sei unnachgiebig. Ich werde, sagte er, mit der Gasmaske innerhalb der normalen Ausbildung in die Gaskammer geschickt. Beim Wechsel der Gasmaske werde sich das Gas im Bart festsetzen und ich bekäme Stickanfälle. Und diesen Wechsel würde man mehrmals durchführen. Bis ich weich sei. Er, der Kompaniechef, würde das überhaupt nicht in Erwägung ziehen und grundsätzlich ablehnen. Aber es sei oben im Bataillon im Gespräch. Und nun schlug er mir einen Handel vor. Er sei, sagte er, von meiner grundsätzlichen Argumentation her einverstanden. Auch die Mehrzahl der Offiziere im Bataillon sähen das, wenn man mit ihnen persönlich spräche, so. Zudem meine er, dass ich auch ihm zuliebe den Bart abrasieren solle. Er bekäme ganz sicher schwerwiegenden Ärger, wenn ich dem nicht nachkommen würde. Was er mir aber versprechen würde: Nach dem Abrasieren könne der Bart sofort wieder spriessen, so dass ich nach den vier Wochen Reservistendienst wieder mit vollem Bart die Kaserne verlassen könnte. Es gänge nur darum, dass ein Befehl ausgeführt werden muss. Ein wenig zierte ich mich noch, redete hin und her, holte aber dann doch meinen Rasierapparat und rasierte den schliesslich Bart ab. Bei aller inneren Ablehnung des soldatischen Lebens muss ich aber zugestehen, dass der Kompaniechef, dessen Namen mir leider entfallen ist, mir als ein äusserst sympathischer und verständnisvoller Mensch in Erinnerung geblieben ist. Natürlich murrten viele aus den Kompanien wegen meines Nachgebens. Aber da war ich eigen. Selbst nichts tun und andere das Aufsässige machen lassen, das kannte ich bisher zur Genüge. So kam alles zur Ruhe und ich lief unrasiert durch den Standort und verrichtete meinen Dienst einmal mit nächtlicher Wache am Munitionsbunker, einmal schlief ich den Wachposten zum Kfz-Park durch, in der Nachtwache stand ein Billardspiel und auch zur Wache am Tor wurde ich abkommandiert und schlief die Zwischenzeiten zum Turnus schon mal probehalber im nicht belegten Knast. In und zwischen den Zeiten passierte einfach nichts Aufregendes mehr. Ausser, dass ich beim Munitionsbunker in tiefer Nacht bei meinem Rundgang durch ein Geräusch und einem Fauchen aufgeschreckt wurde. Jemand musste am Zaun eine Drahtschlinge befestigt haben. Jedenfalls hatte sich eine Katze so verfangen, dass die Schlinge ihr den Hals abschnürte. Es war ein mächtiges Stück Arbeit mit dem gesicherten Gewehr zwischen den Hals der Katze und dem Draht zu kommen. Doch es gelang mir schliesslich, die Katze zu befreien. Die raste ohne Dankesbezeigungen schleunigst davon und ich war froh, dass keine Kontrolle unterwegs gewesen war. Denn ich hatte meine volle Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf die Befreiungsaktion gelegt und den vorgeschriebenen Rundgang und das Wachen selbst völlig vernachlässigt. Kaum war die Katze weg, hastete ich zur nahenden Ablösung an den verabredeten Ort. Ein Mitsoldat hatte dagegen ein ganz anderes Erlebnis. Er hatte Torwache und als neu Eingezogener überhaupt keine Ahnung, wer mit dem Fahrzeug Ein- und Auslass begehren würde. Das, so wurde ihm eingebläut, durfte nur mit ordnungsgemässem Passierschein oder Ausweis geschehen. Als eines Morgens ein grosser Pkw Einlass begehrte, verlangte er die entsprechenden Ausweise. Und da nicht nur die des Fahrers, sondern auch die der im Fond sitzenden Person. Von dieser allerdings wurde er in äusserst lautstarker Form aufgefordert, sofort das Tor zu öffnen. Einen Ausweis jedoch bekam er nicht zusehen. Ein ungeübter Soldat schwankt bei solchen Angelegenheiten immer zwischen Pflicht und Angst, etwas Falsches zu tun. Da aber der Einlass auch eine Kontrolle seiner Aufgabe sein konnte, verweigerte er dem Fahrzeug den Einlass. Erst der herbeigeeilte Diensthabende liess das Fahrzeug unkontrolliert passieren. In ihm sass der Batallionskommandeur und dieser bestand darauf, den widerspenstigen Soldaten sofort einzusperren. Was auch geschah. Natürlich wurde das Ereignis eingehend und mit Schadenfreude erörtert. Besonderes Augenmerk legte man auf die Feststellung, dass eine kräftige Wolke Alkoholdunst aus dem Fahrzeug gekommen sei. Und der Gang des Kommandierenden entsprechend unsicher ausgefallen sei. Von den ansässigen Soldaten konnte man erfahren, dass die Seele des Standortes schlicht und einfach soff und dieser morgendliche Zustand nichts Neues war. Das hätte man dem Einlassdienst allerdings schon vorher stecken sollen. Er, der Einlassposten, kam übrigens, wenn ich mich recht erinnere, sofort wieder frei und soll wegen guter Dienstdurchführung einen von allen Ersehnten Sonderausgang erhalten haben. Dort konnte er dann das tun, was auch der Kommandeur getan hatte. Sich einen antrinken. Denn kaum mehr konnte man in Frankfurt/Oder tun. Zumal den Trinkenden nichts Bedrohliches erwartete. Als ich das erste Mal in der Gaststätte ein paar Biere trank, hatte man Mühe, mich vom zeitigen Aufbruch abzuhalten. Ich wollte jedenfalls pünktlich noch vor zwölf Uhr nachts die Wache passieren, denn bis dahin hatte ich nur Ausgang. Aber die ansässigen Wehrpflichtigen lachten mich aus. Ich würde schon zurzeit abgeholt werden und ich solle ruhig noch ein Bier trinken und mir gar keine Sorgen machen. Nun, mein Bier trank ich schon mit einiger Unruhe. Aber die Unbeschwertheit der Anderen beruhigte mich. Und richtig: Kurz vor Zapfenstreich, also zwölf Uhr, fuhr ein Lkw der Volksarmee vor. Ein Unteroffizier vom Dienst stieg aus, kam in die Gaststätte und forderte alle Soldaten auf, den Raum zu verlassen und auf den Wagen aufzusteigen. Murrend und protestierend kamen die meisten der Aufforderung nach. Die Anderen wurden persönlich und sogar ein wenig nachsichtig aufgefordert, das Bier oder die Dame nun in Ruhe zu lassen und sich zum Lkw zu bewegen. Der fuhr dann auch folgerichtig in Richtung Kaserne und sammelte unterwegs diensteifrig weitere sonst zu spät kommende auf. Er erreichte erst einige Zeit nach Zapfenstreich das Ziel und wurde sofort und ohne Probleme und Kontrolle eingelassen. Im Nachdenken zu dieser Begebenheit kam mir der Gedanke, dass, wenn schon der Bataillionskommandeur ein Säufer sei, man mit eventuellen anderen Trinkern ebenfalls nachsichtig verfahren müsse. Also geht man sorglos saufen und amüsiert sich dabei so gut es eben geht. Man wird schon eingesammelt. Jedenfalls wussten wir nichts Besseres, aber die Geschichte wäre damit rund und der Gerechtigkeit genüge getan. Anders war es mit der nächsten Sache. Eine grosse Veranstaltung sollte starten und wir wurden aufgefordert, uns entsprechend einzurichten: Wer nimmt teil, wer hat Dienst, wer führt Aufsicht. Ich kann mich wegen des Anlasses schlecht erinnern, aber es wurden Berichte über die geleisteten Taten zum Schutze des Sozialismus verlesen. Und es waren Soldaten der Sowjetarmee als Ehrengäste geladen. Sie sassen in den vorderen Reihen. Nun sind solche Veranstaltungen stinklangweilig und bieten überhaupt keine Ablenkung, so dass man in Gedanken vor sich hin döst und recht eigentlich froh ist, wenn der Spuk vorüber gegangen ist. Plötzlich aber wurde ich aufmerksam. Gerade hatte ein Offizier, ich glaube es war ein Leutnant, einen, ja sagen wir, wahnwitzigen Satz verlesen. Eigentlich sollte der Litzenträger über die Tätigkeiten der Freien Deutschen Jugend berichten, dessen Sekretär er im Standort war. Er hatte aber nichts Wesentliches zu berichten. Man hatte ja nichts getan. Statt dessen fabulierte er über das Bewusstsein der Soldaten und hatte eine abenteuerliche Formulierung parat: „Die Soldaten der Nationalen Volksarmee lieben die Soldaten der Sowjetarmee mehr als ihre eigenen Verwandten in Westdeutschland“. Das schreckte zu Zeiten zweier Deutscher Staaten und der nicht enden wollenden Polemik über einen allzeit drohenden Angriff von Seiten der kapitalistischen Staaten niemanden auf. Während ich noch innerlich meinen Kopf schüttelte, hatte dies aber doch jemanden erheblich gestört. Es gab von den Normaldienstlern unter den Soldaten einen Schreiber vom Stab. Dieser hinkte stark, war aber trotzdem eingezogen worden. Er war sogleich dienstuntauglich geschrieben worden. Aber er wurde im Innendienst eingesetzt und brauchte an allen anderen körperlichen Aufgaben nicht teilzunehmen. Der Name ist mir haften geblieben: Gefreiter Decker. Er war uns allen recht sympathisch und er gab zu verstehen, dass er lieber vom Armeedienst freigestellt worden wäre. Was wir ja auch gern gewesen wären. Nun, diesen störte die Sache schon und er stellte den Antrag, diesen Satz aus dem Rechenschaftsbericht des FDJ-Sekretärs zu streichen, weil es eine Alternativfrage wäre, die in keinen Bericht gehöre. Das wurde rigoros abgelehnt. Nun meldete ich mich zu Wort und es kam zu einem heftigen Wortwechsel, indem ich unterstellte, dass mit diesem Satz die Untätigkeit der Führung der Jugendorganisation verdeckt werden sollte. Denn ausser Radio hören, trinken und langweiliger Zeit verschlafen sei mir nichts aufgefallen, womit ich mich nach Dienst sinnvoll beschäftigen könne. Das schaffte allgemeinen Aufruhr und viele Wortmeldungen anderer. Einer, so erinnere ich mich im Nachhinein vergnügt, stellte sogar den Antrag, man möge die Diskussion abbrechen und mir in der eigenen Truppe erst einmal das Freund-Feind-Problem mit dem Klassenfeind erläutern. Es fehle mir schlichtweg an Bewusstsein. Bei solchen Wortwechseln werde ich munter und mein Geist schärft sich unwillkürlich. Der Gedanke eines tiefen Unrechts und der Empörung nimmt von mir Besitz, und ich fange an, mein Gehirn zu aktivieren und mich wortreich zu verteidigen. Jedenfalls ist mir in Erinnerung geblieben, dass sich viele umdrehten und mich erstaunt oder wütend musterten und besonders sind mir die völlig verdutzten Gesichter der Sowjetsoldaten in der Erinnerung haften geblieben. Die Veranstaltung wurde zunächst unterbrochen, eine Pause eingelegt und schon stürzten etliche Offiziere auf mich zu, um mich zu agitieren. Jedenfalls sollte ich von der Richtigkeit des sozialistischen Gedankengutes überzeugt werden und man zweifelte mein Bewusstsein für den Sozialismus an. Die Pause war zu Ende und ich bat um ein letztes Wort. Mir war nämlich ein feiner Gedanke gekommen. Wenn ich, sagte ich langsam und deutlich, nun der Sohn von Max Reimann wäre und folgerichtig in der DDR leben würde, müsste ich also die Soldaten der Sowjetarmee mehr lieben, als meinen Vater im Westen, obwohl er dort Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Westdeutschland wäre. Das sei nicht nachzuvollziehen. Es gab einen höher dekorierten Gast im Präsidium der vorn Sitzenden. Ich hatte nur erfahren, dass er extra aus Berlin gekommen war. Also einer aus der Regierungsebene. Mehr wusste ich nicht. Aber ich hatte bemerkt, dass dieser dem ganzen Ablauf ganz gelassen, ja fast ein wenig vergnügt gefolgt war. Er erhob sich jetzt und erklärte den Bericht für beendet und man würde die Angelegenheit in der Leitung besprechen. Ich habe nicht wieder davon gehört und auch nicht nachgefragt. Doch, etwas bewegte sich. Ich wurde zum Kompaniechef gerufen und befragt, was ich denn so meine, womit sich die Soldaten nach Dienst beschäftigen könnten. Da war ich schnell bei der Hand. Wir würden beklagen, sagte ich, dass nicht ein Musikinstrument existiere. Ich würde zum Beispiel gern Gitarre spielen und ein anderer jammere, dass er das Schifferklavier Zuhause lassen musste. Wir hätten damit genügend Gemütlichkeit und Beschäftigung. Dann konnte ich wieder gehen. Kurze Zeit später wurde ich mitten aus dem Unterricht zum Kompaniechef gerufen. Nach dem Eintritt und meiner Meldung bedeutete er mir, ich solle den Schrank dort aufmachen. Sehr erstaunt machte ich das und mich erwartete eine echte Freude: Im Schrank stand eine nagelneue Gitarre und eine frisch gekaufte Ziehharmonika. Meine Freude zeigte ich offen und bedankte mich herzlich. Ich solle, sagte er, darüber verfügen, sie benutzen und gut pflegen und zum Ende der Dienstzeit wieder abliefern. Das war schon etwas. Denn wer den Wind sät und einen warmen Hauch dafür erhält, der macht sich schon so seine Gedanken über den Apparat, der über einen schwebt und volle Befehlsgewalt hat. So falsch konnten meine Ansichten – und um die ging es ja grundsätzlich – nicht gewesen sein. Ja, ich rechnete mir sogar gewisse Sympathien weiter oben aus. Vielleicht habe ich aber auch nur den erwarteten Nebeneffekt übersehen. Ich gab nämlich Ruhe und muckte nicht mehr. Aber ganz zum Schluss konnte ich doch noch einen Schwinger landen und Rache nehmen. Als der Reservedienst nach vier Wochen zu Ende ging, meldete sich eine Revision aus dem zuständigen Ministerium an. Ein Armeebeauftragter, oder wie er damals auch hiess, kam zu einer Untersuchung. Bei ihm, wurden wir belehrt, könne man seine Bedenken und Beschwerden vorbringen, ohne dass dies irgend einen Nachteil für den sich Beschwerenden haben sollte. So etwas kannte man aber in der DDR. Erst sollte man seine Meinung sagen. Dann wurde man attackiert und zuletzt spürte man, dass man benachteiligt wurde. Doch mich störte das wenig. Ich war ja weder in der Partei, noch in der FDJ oder in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Dafür hatte ich schon Nachteile in Kauf nehmen müssen, aber diese immer durch Leistung und dadurch, dass man genügend Gleichgesinnte fand, ausgleichen können. Der eigentliche Gedanke an Rache kitzelte mich aber erst am Tage der Befragung. Wir mussten uns dazu auf dem Exerzierplatz einreihig in einer langen Schlange aufstellen. Der Erste in der Reihe musste zehn Schritte vortreten, Meldung vor dem Genossen aus Berlin machen und konnte dann seine Bedrängnis, aber natürlich auch den Dank an den sozialistischen Staat loswerden. Das war zwar nicht ursächlich gefragt, aber immer so üblich. Und wurde so auch erwartet. Es ging verhältnismässig schnell und der hinter dem Beauftragten stehende mit angereiste Schreiber machte nicht allzu viele Notizen. Als ich an die Reihe kam, wurde ich mit den jovialen Worten begrüsst: „Na, Ihr Bart ist ja gleich wieder dran.“ Der Dekorierte war also ganz offensichtlich vorsorglich informiert worden. „Ja, sagte ich, „und ich bin froh darüber, dass er wenigstens etwas schnell wächst.“ Also, meinte er darauf hin, dann sei das Problem ja aus der Welt geschafft. Nein, meinte ich. Denn ich kann nicht einsehen, dass mir mein Bewusstsein für den sozialistischen Staat immer wegen Äusserlichkeiten abgesprochen werde. Ich hätte mich, als noch niemand zur Volksarmee gehen musste, für zwei Jahre freiwillig verpflichtet und müsse mir nichts bieten lassen. Ich hätte während der zwei Jahre Funkstationen in Stückzahlen und während laufender Übungen repariert. Wogegen ich hier und angeblich zu meiner Qualifikation mal eine Funkstation hinter einer abgesperrten Kette sehen, aber um Gottes Willen nicht anrühren durfte. Ich wüsste nicht, was ich hier dazu gelernt hätte und was das mit Gefechtsbereitschaft zu tun hätte. Das Schlimme aber sei, dass nicht mein Bart die Einsatzbereitschaft einer Truppe in Frage stelle, sondern ein offensichtlich oft betrunkener Kommandeur. Er schwäche aus meiner Sicht die Kampfbereitschaft und das Bedrückende sei, dass jedermann das wisse und sich die Soldaten darüber amüsieren und die Moral bedrohlich sinke. Es wurde sofort notiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das nun etwas genützt hat. Wie ich aber den Staat in Erinnerung habe, dürfte es vor der Parteileitung doch zu unliebsamen Augenblicken für den Trinker gekommen sein. Denn zu damaliger Zeit hatten sich Parteigenossen auch vor der Leitung zu verantworten, wenn sie sich von ihrem Partner scheiden lassen wollten. Warum also nicht, wenn sie tranken. So kann ich mir schon vorstellen, dass meine Rache süss war - und das sie zum Leben gehörte. Hans Nerger zum Anfang der Geschichte 6. Das Hämmerchen oder: Ein Feind wird zu Luft Als ich meine Arbeitsstelle wechselte, vom Mittelwellensender in Wilsdruff, den man schon von der Autobahn her am schlanken Sendemast von Weitem erkannte, zum Institut für Elektronik ins Schloss Eckberg, kurz vor der Anfahrt auf den Dresdener Weißen Hirsch, waren mir nur fünf wunderschöne Jahre in der reizvollen Umgebung gegönnt: Ein voller Blick wie von einem Balkon über die Elbe und das gesamte östliche Rund von Dresden. Dann zogen wir in die Stadtmitte von Dresden ins Atrium, gleich schräg gegenüber vom Rathaus, ein. Und verloren den schönen und zarten Namen Institut, um unter dem neuen mächtigen Namen „VEB Kombinat Robotron, ZFT“ zu werkeln. Wobei das Kürzel ZFT für Forschungszentrum stand. Unsere Aufgabe in einer kleinen Gruppe so von fünf bis sechs Mann war, für die einzelnen Forschungsabteilungen benötigte diverse Messgeräte und Hilfsgeräte in Schuss zu halten, aber nicht nur in der Funktion, sondern auch in den gewünschten Daten. Das begann, und es war ja 1966 als ich in das zirka 4000 Personen grosse Forschungszentrum eintauchte, mit sehr viel einheimischer und selbst erstellter Technik. Weitete sich später zu Importgeräten, wenige aus den Ostblockstaaten, aber immer mehr aus dem NSW, dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, aus und ich erinnere mich an französische Oszillographen der Firma CRC, an hochwertige Frequenzzähler und spezielle Oszillographen, genannt Samplings, der amerikanischen Firma hp. Diese Geräte wurden zunehmend über abenteuerliche Wege beschafft, weil für sie ein Embargo, ein Exportverbot für die sozialistischen Länder bestand. Entweder wurden sie als Gebrauchtgeräte von den internationalen Messen geholt oder, wie wir an der Verpackung sehen konnten, kamen sie aus den unterschiedlichsten ostasiatischen Entwicklungsländern. Es war ein Wirbel, in den wir eintauchten. Mit stetigen Veränderungen an Organisationsformen und Vorgesetzten. Mit neuen Bekannten, Kollegen und Aufgaben. Ein Monster, ein Kombinat, zunächst unübersichtlich, unpersönlich und nicht zuletzt verschwenderisch freizügig in der Ausstattung. Da freilich auch wieder begrenzt durch den mächtigen Betonbau, mit unendlichen Gängen im Atrium ringsherum zu erlaufen. Und unerträglich heiss in den trockenen Sommermonaten, in denen der Beton sich speicherhaft erhitzte, weil er schlecht isoliert war. Aber nicht heiss genug, um die sich langsam ausbreitende Invasion von Schaben zu vernichten. In den letzten Zeiten hängte ich meine Aktentasche an die Decke, um keinen unliebsamen Gast aufzulesen und mit nach hause zu bringen. Aber die Tierchen waren mehr auf den dunklen Gängen zu finden, an den in Wiederkehr eingebauten Nischen mit den Waschbecken und den einfachen Abdeckungen, hinter denen die Rohre verschwanden und mit ihnen die unappetitlichen Mehrfüssler. Gleich bei meinem anfänglichen Wechsel ins Institut lernte ich einen älteren Kollegen kennen, gross, schlank, interessiert. Der Herr David. Er arbeitete allerdings noch in einer Aussenstelle und kam sicherlich aus Neugierde mal ins Schloss Eckberg und um vorbeizuschauen, wie der Neue so sei. Ich sass damals gerade vor einem elektronischen Spannungsregler mit mehreren Ausgängen. Das Gerät streikte, sollte repariert werden und es war kein Schaltplan vorhanden, nach dem man logisch vorgehen konnte. Solche Geräte, zumal die im Eigenbau, bestanden zu diesen Zeiten nicht aus wenigen Bausteinen, sondern noch aus vielen einzelnen Bauelementen. Drähte zogen sich wie Spinnweben über einzelne Pertinaxplatten*, die noch keine Leiterbahnen hatten. Die Transistoren zur Regelung hatten lange Beine und waren alle noch einzeln auswechselbar. Franz David schaute kurz und interessiert und still zu, wie ich mich abmühte, den folgerichtigen Schluss zu ziehen, wo denn nun der Fehler liegen könnte und was ich auszuwechseln hätte. Er verabschiedete sich recht bald mit ein paar nichts sagenden Floskeln von mir und ging. Als einen Tag später der Abteilungsleiter nach mir und meinen eventuellen Fortschritten sah, klagte ich ihm mein Leid, keinerlei Unterlagen und Schaltpläne zum Gerät zu finden. Ja, meinte er, da wäre doch der Kollege David bei mir gewesen und der hätte doch für diese Art der Geräte und für dieses im Besonderen alle Unterlagen in der Aussenstelle. Ob er mir das nicht gesagt hätte? Nein, sagte ich, kein Wort hätte er darüber verloren, obwohl ich mich schon beschwert hätte. Na, schüttelte er darauf den Kopf, das sehe ihm wieder mal ähnlich. Rufen Sie ihn an, meinte er noch, und fordern Sie die Unterlagen ab. Was ich dann auch machte. Das war meine erste und damit prägende Begegnung. Franz David unternahm denn auch in Zukunft alles, um selbst immer am Ball zu sein und mir keine Luft zu geben. Erst ein wenig später merkte ich, dass er auch den Anderen gegenüber nicht gerade der Gentleman war. Als ihn einmal auf der Strasse ein Kollege aus einer anderen Abteilung mit einem Shiguli* überholen wollte, während er im Trabant* noch vorn war, zog er nach links auf die Strasse und verhinderte so den Überholvorgang. Beim Abstellen der Fahrzeuge an der Arbeitsstelle zur Rede gestellt, was das zu bedeuten hätte, antwortete er knapp: „Ich bin der Meinung, bei Tempo 50 hat mich niemand zu überholen“. Damit ist aber auch schon der Finger auf der Wunde. Es hatte ihn niemand zu überholen. Und so war er bei allem bedacht, dass er immer der Erste sei. War er es nicht, dann gab es Ärger, weil er immer meinte, dass er es doch sei. Nun, mit solchen Menschen kommt man, je länger man mit ihnen zusammen ist, immer schlechter aus und man tut gut daran, diesen zielstrebig aus dem Weg zu gehen. Da dies aber schlecht geht, wenn man zusammen in einem Raum arbeitet, bleibt ja nur noch die Taktik übrig, den anderen mehr oder weniger unauffällig als Luft zu betrachten. Über einen langen Zeitraum ging dies recht und schlecht. Er hatte die Angewohnheit überall zu sticheln und zu probieren, ob sich nicht doch ein Lüftchen zu seinen Gunsten drehen könnte. Man merkt es recht unangenehm, wenn jemand keine Ruhe gibt. Aber schliesslich schleift es sich ein und ich tat, was seine Person betraf, so gut wie völlig desinteressiert. Nach aussen kann man ja viel transportieren, aber im Untergrund ist nicht immer alles plan. Es sass mir ein feiner Groll tief innerlich. Sozusagen auf der Warteschleife. Er wartete auf eine Gelegenheit und die ergab sich eines Tages. Dazu ist zu erzählen, dass es im Atrium wie erwähnt eine Menge Forschungsabteilungen, in den unteren Etagen aber Handwerker und weiter oben die Telefondienstler gab. Robotron versorgte sich mit allem selbst und hatte sogar Fussbodenleger eingestellt, um das Linoleum auf den Gängen in Schuss zu halten. Na, jedenfalls so ungefähr in der Mitte hatten die Kombinats- und die Parteileitung ihren Sitz. Das war nicht allzu weit von unserem grossen Arbeitszimmer entfernt. Aber eben auch nicht allzu nah, so dass man sich nicht jeden Tag über den Weg lief. Aber wer dort arbeitete, das wussten wir schon. Besonders wenn es sich um eine attraktive und dazu sehr nette Blondine handelte. Man grüsste sich freundlich, lächelte sich zu, hielt aber einen kleinen Abstand. Das war immerhin die Kombinatsleitung und die Dame war die Chefsekretärin. Eines Tages öffnete sich die Tür zu unserem grossen Arbeitsraum und die Blondine steckte ihren Kopf zur Tür herein. Kollege Nerger, sagte sie, da ich gleich an der Tür sass, ich habe da ein Problem. Hätten sie vielleicht ein Hämmerchen für mich? Und da war meine Warteschleife im Kopf beendet. Oh, sagte ich, das bedaure ich aber sehr, ich habe bloss einen Hammer. Aber wenn Sie einen Kollegen mit einem Hämmerchen suchen, da kann ihnen der Kollege David dort hinten ganz sicher helfen. Ich habe es noch in Erinnerung, wie sie mich anschaute. Kein bisschen Groll. Volles Interesse und bleibendes Lächeln. Nur eine feine Röte überzog ihr Gesicht. Und sie zögerte nur kurz, liess sich von Franz David das Hämmerchen geben und verlies mit einem Dankeschön und einem kleinen Augenblitz zu mir den Raum. Sie hatte wohl begriffen, dass es hier nicht darum ging, eine Frau zu foppen. Sondern dass hier Männer ernstere Rangeleien hatten. Da ging man lieber schnell hinweg. Das war auch gut so, denn kaum war die Tür zu, war der Krach perfekt. Ich verbitte mir ein für alle mal, brüllte Franz los, dass du mich vor anderen Leuten lächerlich machst. Aber das war schon vergebliche Mühe. Denn wir waren insgesamt wohl fünf oder sechs Personen im Raum und bogen uns vor Lachen. Selbst über den Tag konnten wir uns nur schwer beruhigen. Nach meiner Ansicht - und darum geht es in der Geschichte – hatte sich das geduldige Warten aussergewöhnlich gut gelohnt. Ich hatte ab sofort meine völlige Ruhe und Franz war wirklich Luft für mich. Er verlies uns schon bald. Wenn ich auf dem Gang zufällig die Chefsekretärin traf, lächelte sie mir jedes Mal ein bisschen verschworen zu. Allerdings mit einem kleinen Hauch von Rot im Gesicht. Aber das stand ihr zu den blonden Haaren recht gut. * Erläuterungen: Pertinax war ein starres Grundmaterial als Träger für elektronische Schaltungen gedacht. Shiguli war ein in der Sowjetunion hergestelltes Auto für nicht sonderlich schlecht Verdienende. Mit der gleichen Wartezeit bei der Bestellung, also so zehn fünfzehn Jahre, wie auf den Trabant. Der war das Transportmittel der kleineren Verdiener. Ein viereckiger Plastwürfel mit lautem Motor. Ich konnte mich nie für ihn erwärmen. Hans Nerger zum Anfang der Geschichte
5. Bei Robotron - Manche Dichter sind nicht ganz dicht. Robotron. Das Atrium. Wir waren von einem grossen Raum mit dem Blick zum Innenhof und einer kleinen unauffälligen Halde unter uns auf die attraktive Aussenseite mit dem Blick auf den Rathausturm, den Körnerplatz und dem mässigen Gewimmel der sich kreuzenden mehrspurigen Fahrbahnen umgezogen. Es War lauter. Es war wärmer. Weil die Sonne anlag. Aber wir hatten Einzelzimmer mit abgeschlossenen Türen, weil es elektrische Betriebsräume waren. Wir, so fünf, sechs Mann, hatten als Aufgabe, für die einzelnen Forschungsabteilungen benötigte diverse Messgeräte und Hilfsgeräte in Schuss zu halten, aber nicht nur in der Funktion, wie gesagt, sondern auch in den gewünschten Daten. Ich schrieb vorhin gerade von einer kleinen unauffälligen Halde, die sich unter uns befand, als wir noch in den grossen Raum arbeiteten. Nun, ja, Halde war übertrieben. Wenn man sich einen grossen viereckigen Innenraum als Hof vorstellt, in dem einmal tausend Rosen angepflanzt werden sollen, so lautete jedenfalls der ursprüngliche Plan, und man dann weiss, dass der Innenhof noch unbepflanzt mit dieser Spezies war, aber dafür übersät mit Betonsteinen und Bauresten und mit wilden Pflanzen aller Art, die aber immerhin über mindestens fünf Stockwerke ihren Samen hatten einfliegen müssen, könnte man eine ungefähre Vorstellung davon erhalten, wie eine kleine Halde darin aussieht, auf die man von oben herab - wir kampierten in einer Ecke des Vierecks in ersten Stock - leere Flaschen, Kronenkorken von Bierflaschen, Korken von Weinflaschen der Firma Rowebo und auch schon mal eine defekte aber noch wunderschön laut implodierende Bildröhre hinuntersausen lassen konnte. Es knallte und hallte im Innenhof. Man wusste nicht recht, wer denn gerade etwas deponiert hatte. Wir hatten deshalb unseren Spass. Die wilden Pflanzen deckten alles milde und ungerührt zu. Jetzt waren wir in den separaten Aussenräumen, zwar immer zwei Kollegen mit Innentüren verbunden, aber sicher vor Eindringlingen, denn unsere Türen hatten unter der Klinke eingebaute Vierkante zum Öffnen eingesetzt und solche Schlüssel hatte nicht jeder. Mit dem Umzug hatte sich die Organisation des ZFT - Zentrum für Forschung und Technik - schon verbessert. Die Gänge leerten sich von abgestellten Möbeln und es kam Routine in die Abläufe. Unterdessen führte man eine morgendliche Zeitungsschau ein. Man hatte sich eine halbe Stunde vor Dienst einzufinden und ein Parteigenosse der SED informierte über die neuesten Erfolge und Vorhaben der Sozialistischen Einheitspartei und der Sozialistischen Staatsführung. Es war langweilig, uninteressant und unprofessionell ohne Ende. zwischenzeitlich wurde sogar zum Parteilehrjahr aufgefordert, an dem man teilnehmen sollte, ohne Mitglied in der SED zu sein. Ich erinnere mich noch deutlich, wie ich mich einmal heftig beschwerte, weil mir der Kragen platzte. Ich soll, bemängelte ich, mit jedem Pfennig, mit jeder Minute und mit jedem Gramm sparen, um den Sozialismus stärken und aufbauen zu helfen. Aber ich muss hier herumsitzen und mir wirklich unqualifizierte Meldungen anhören, die ich abends wesentlich besser und logischer im Fernsehen erhalten könne. Nun, es nutzte nicht viel, ausser dass die Betriebsamkeit langsam und sicher einschlief und dem normalen Arbeitsablauf Platz machten. Um beim gelegentlichen Trinken zu bleiben: Da hatten wir unterdessen eine gut funktionierende Routine erarbeitet. Wir hatten nicht immer Durst. Aber wenn, wussten wir die Wege, etwas zu beschaffen und zu lagern. Das leere und feste Gehäuse eines alten Tonbandgerätes - ich erinnere mich, es war die eines Namens Smaragd und gehörte mir - diente dazu, durch die Räume und das Gelände transportiert zu werden, um höchstwahrscheinlich und in der Regel Bier zu holen. So in die Räume gebracht, wurden die Heizungskästen, die unter den Fenstern angebracht waren und unten mit einer schmalen Reihe von nicht abstellbaren Heizkörpern ausgestattet waren, die gleich darüber mit einer breiten Klappe bedient werden konnten, um leidlich die Hitze abzudämmen, mit Flaschen gefüllt. Die Höhe dieser tollen Erfindung war ungefähr dreissig bis fünfunddreissig Zentimeter hoch, der Rest des Blechkastens, also mindestens vierzig Zentimeter in der Höhe, hatte Platz für Bierflaschen oder andere Getränke. Im Winter hatte dies den Vorteil, sogar vorgewärmtes Bier zu erhalten. Das wurde gern in Anspruch genommen. Wer kaltes wollte, konnte sich ja aus dem Tonbandkasten eine Flasche holen. Trotzdem lag, wenn man alles aufmerksam verfolgte, ein politischer Druck über dem Ganzen. Ich erinnere mich, dass ich schon ein Problem bekam, als mich eines Tages eine Überraschung erwartete. Die Kusine meines verstorbenen Vaters und ihre Familie kam zu einem Kurzbesuch im Westauto an und rief über das Telefon vom Einlassdienst - es gab noch keine Funktelefone - mich zum betriebseigenen Parkplatz hinunter. Es waren nur zehn Minuten, in denen wir uns schnell drückten und kurz austauschten, aber sie reichten aus, um misstrauische Fragen entgegenzunehmen, wieso ich mit Personen reden würde, die offensichtlich aus Westdeutschland kämen. Ich hätte doch unterschrieben, keinerlei Kontakt mit Bundesbürgern zu haben, dürfe keinerlei Briefe in das kapitalistische Ausland senden oder sie empfangen. Ich weiss nicht recht, wie der Ablauf war. Ich weiss nur, wie ich es aufnahm. Genervt, unbelehrbar und kopfschüttelnd. Interessanter war da schon ein anderes Vorkommnis. Eines Tages klopfte es an meine mit dem Vierkant gesicherte Tür. Als ich öffnete, stand eine Kollege - man sagte damals zu jedem im Forschungszentrum Herumlaufenden Kollege - davor, den ich nur flüchtig kannte. Wenn wir uns zufällig sahen, grüsste er zwar stets freundlich, gehörte aber offensichtlich zum nahen Umfeld entweder der Partei- oder der Kombinatsleitung an. Er begehrte meine Hilfe. Seine Frau sei im Auslandsdienst tätig und hätte infolge dessen einen guten Zugriff zu Devisen. Das war ein Ausdruck für Geld, das nicht aus der DDR stammte und entweder aus “Westgeld” oder Dollars bestand. Wer zu ihm Zugriff hatte, konnte sich sehr Begehrliches aus dem Ausland leisten. Er kam unverblümt zum Anliegen. Er hätte privat eine Tonbandmaschine aus dem NSW (nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet) erstanden und einige Zeit in Betrieb, die sehr teuer und von hoher Qualität sei. So ein Gerät können man selbstverständlich nicht in normalen Reparaturwerkstätten abliefern. Deshalb hätte er die inständige Bitte, dass ich als Spezialist der Elektronik doch mal hineinschauen solle, das gerät sage kaum noch etwas. Es solle nicht mein Schaden sein. Das lehnte ich zunächst erst einmal ab. In der Arbeitszeit sei das überhaupt nicht möglich, wir hätten unsere Aufgaben und unsere Vorschriften. Und wenn ich das nach Dienst erledigen würde, dann völlig ohne Gegenleistung und gleich gar nicht gegen Geld. Nun, wir redeten eine Weile hin und her. Schliesslich gab er mir zu verstehen, dass er von der oberen Leitungsebene her komme und das aus dieser Richtung aber auch gar nichts Nachteiliges käme. Nur andere und untere Mitarbeiter von Robotron sollten von diesem Gerät möglichst nichts erfahren. Schliesslich war ich überredet und stimmte dem zu. Kaum war das Gerät in meinem Zimmer, scharten sich die Kollegen um mich und wir öffneten das sehr professionell und gut aussehende elektronische Wunder. Es ist immer ein Jammer, wenn man in einer Forschungsfirma arbeitet, die inländischen Geräte kennt und mit neuester Technik konfrontiert wird. Mit der Tontechnik waren wir sehr vertraut. Tonbandgeräte waren ohne Probleme zu warten. Hier allerdings stand eine neue Qualität. Die Tonköpfe waren damals aus Aluminium und schliffen sich nach einiger zeit ab. Man wechselte sie bei unseren Geräten eben schnell mal aus. Diese hier bestanden in der Einfassung aus Glas, nutzten sich natürlich nicht ab, waren nur total verschmiert, weil das in der DDR hergestellte Bandmaterial einen hohen Abrieb hatte. Ein wenig Reinigungsbenzin und alle Pracht der Funktion und Wiedergabe der mitgebrachten Musik auf dem Band liess uns erschauern. Ja, das war ein Gerät. Jetzt kam das Problem. Nach Dienst wollte ich es reparieren. Allein es war schon fertig. Im Arbeitsraum stehen zu lassen, war viel zu riskant. Wenn dieses Gerät abhanden kam, nicht auszudenken. Also, alle wieder ins eigene Zimmer und der Anruf: kein Problem, blanke Lappalie, kein nicht zu beschaffendes Bauteil ist defekt, alles geht wieder. Das Tonbandgerät wurde sobald wieder abgeholt. Einkleiner Haufen von drei Scheinen und ein paar Münzen blieb auf meinem Schreibtisch, liess sich nicht zurückgeben und die Tür schloss sich nach einem herzlichen Dankeschön. Zusammengekramt und gezählt lagen auf dem Tisch insgesamt fast fünfzehn Dollar. Geld, das man nicht haben durfte. Geld, das Wege zu schönen Wünschen öffnen konnte. Eine vertrackte Situation, die ich einfach löste. Die Dollars steckte ich ein. Und ich wusste auch wozu ich sie verwenden wollte. Der Dollar stand ungefähr zwei zu eins zum Westgeld und dieses zehn zu eins zum Ostgeld. Das waren also in Ostgeld zirka dreihundert Mark. Die ich jahrelang auf jeder Urlaubsfahrt im Auto gut versteckt nach Ungarn, in die Tschechoslowakei oder Polen, Rumänien und Bulgarien, sogar einmal bis zu einem Kurztrip in die Sowjetunion mitnahm. Als Sicherheit und wenn man Probleme irgend einer Art haben würde, das würde beschleunigt helfen. Der Witz will es, wir haben das Jahr 2005 und ich habe das Geld immer noch in der Wohnung versteckt. Ich weiss nur nicht genau wo. Der Eigentümer des Tonbandgerätes kam in weiten Abständen zu einem Plausch zu mir. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum. Er war mir natürlich nicht unsympathisch, aber er gehörte zur undurchsichtigen Leitung des Unternehmens und es war Vorsicht angesagt. Ich war nicht Mitglied in der Partei, war einer von nur zwei Personen von den insgesamt viertausend, die im ZFT nicht in der DSF, der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft waren und trat zuletzt sogar aus der Gewerkschaft aus. Wer die DDR kennt und dazu noch hoch angebundene volkseigene Grossbetriebe, der kann die damaligen Gefahrenelemente und Benachteiligungen schon einschätzen. Mir gelang es trotz bester Leistungen im Fach nie, einmal Aktivist zu werden. Du bist, sagte man mir stets, fachlich bestens, aber die fehlt das gesellschaftspolitische Engagement. Dich bekommen wir bei der Beantragung nicht durch. Und damit sind mir je Antrag immer siebenhundert Ostmark entgangen. Also der Eigentümer des Tonbandgerätes kam in weiten Abständen zu einem Plausch zu mir und ich war vorsichtig. Aber langsam setzte sich bei mir der Gedanke durch, dass es weder einen Auftrag hatte, mich auszuforschen, noch sonst einen Kontrolle durchführte, sonder dass er einfach nur unbeschwert reden und sein Herz ausschütten wollte. So erzählte er mir, dass er im weitesten Sinne für die Sicherheit der Forschung im betrieb zuständig sei und er Sabotage aller Art abhalten solle. Dass ihn aber unglaubliche Kindereien begegnen würden. So können er zu Wochenbeginn unter seine Tür geschobene Mitteilungen lesen, in denen Kollegen aus den Forschungsabteilungen angeschwärzt würden, weil übers Wochenende ein Westauto vor ihrem Haus geparkt hätte. Und diese Zettel, erboste er sich, sind ohne Unterschrift oder Namensnennung. Feige Denunzierungen, schimpfte er, das mache keinen Spass. Was tun sie denn damit, Fragte ich ratlos. Was sonst, als es alles in den Papierkorb schmeissen, entgegnete er. Das gesellschaftspolitische Bewusstsein wurde hoch eingestuft in solchen betrieben. Dazu kamen die Aufforderungen, in der Kampfgruppe des Betriebes im Verteidigungsfall mit zu helfen. Und dazu waren öfter an den Sonnabenden Übungen der Kampfgruppen der Mitarbeiter des Betriebes nötig. Mitleidig habe ich stets gesehen, wenn diese Übungen angesetzt wurden. Einen Beitritt zur Kampfgruppe habe ich stets abgelehnt. Der stete Hinweis auf die Friedenspolitik des eigenen Staates und die beschworene Bedrohung durch den Klassenfeind schärfte den inneren Verstand zur Politik ganz ungemein. Immer kritischer beleuchtete man die politischen Tätigkeiten der Verantwortlichen aller Positionen, verglich Rede und Tun und kam immer mehr zu der Überzeugung, dass so viel nur Schaum und Geschwätz war. Der Staat mit all seinen Tun lässt es gar nicht zu, dass man für ihn überzeugt sein kann, sagte ich mir damals und je überzeugter Personen vor mir auftraten, desto misstrauischer wurde man. In der Gruppe kam man zunehmend zu der Überzeugung, dass es in der Überzahl nur verbohrte Dumme sind, die die Politik rückhaltlos vertreten oder Gesinnungslumpen, die des eigenen Vorteils willen so reden und nur wenige Wesenlose, die alles glaubten. In der zeit hatte ich an meiner Tür dem Ausgang zu verschiedene interessante Artikel angehängt. Das waren in der Regel kleine Zeitungsartikel oder Ausschnitte, die etwas beweisen wollten, aber jedes Mal keinen Beweis lieferten, sondern nur Behauptungen aufstellten. Aber es waren mir auch verschiedene Besonderheiten aufgefallen, die ich angehangen hatte. Unter anderem hatte ich in irgend einer Zeitung ein Gedicht aufgelesen, es ausgeschnitten und an die Tür gehängt. Wenn ich mich so recht erinnere, war das Gedicht von Max Zimmering, zur DDR-Zeit allgemeinbekannt, und es hiess: Lob der sozialistischen Integration. Dann folgten Verszeilen von für mich so wirren Lobpreisungen des sozialistischen Wirkens und Schaffens, dass ich kurzerhand mit Füllhalter meine Einschätzung darunter schrieb: Manche Dichter sind nicht mehr ganz dicht. Der Zufall wollte, dass unser zuständiger Direktor im Zimmer meines Kollegen nebenan etwas mit diesem zu besprechen hatte. Er war einer der Überzeugten, die an nichts und niemanden einen Zweifel hatten, wenn es um den Sozialismus ging. jedenfalls machte er diesen Eindruck und für mich war er in dieser Frage sehr glaubwürdig. Ich erinnere mich, dass wir einmal zu einer kleinen Betriebsfeier ein Streitgespräch über den schlechten Zustand der Strassen führten. Ihn war es völlig logisch, das ein berechtigter Mangel an einem dazu benötigten Material vorlag. Der Mangel hatte sicher einen triftigen Grund und damit sollte man es bewenden lassen, meinte er. Hingegen war ich damit überhaupt nicht einverstanden und meinte, man solle statt dessen lieber mehr Autos herstellen, da könne man einmal die Wartezeiten drastisch verringern und gleichzeitig mit den Einnahmen genügend Strassen reparieren und sogar noch ausbauen. Er schaute mich damals wirklich entsetzt an und sagte dann eindringlich, ohne den Blick von mir zu wenden: Aber Hans, das sind ja kapitalistische Gedanken. So einer war das. Er war unterdessen mit dem Gespräch im Nebenraum fertig und brach auf. Beim Hinausgehen wollte er meine Tür öffnen, verharrte aber und las offensichtlich das Gedicht und meine Einlassung dazu. Er blieb länger stehen, als man zum Lesen des Gedichtes gebraucht hätte. Ich glaubte zu bemerken, dass er anstrengend überlegte. Ich sagte sicherheitshalber nichts und arbeitete ungerührt weiter. Dann öffnete er die Tür und ging ohne sich umzusehen oder etwas zu sagen hinaus. Ich bin mir heute noch unsicher, was seine Ansicht dazu war. Meine hatte ich jedenfalls eindeutig und klar kundgetan. Hans Nerger zum Anfang der Geschichte
|
|||||||