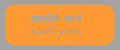 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
Geschichten 17 und 18 |
||||||||
|
17. Der alte Mann in Thüringen Im Jahr 1947 wurde unsere Familie aus Wigandstahl im Isergebirge kurzerhand vertrieben. Das ging ganz schnell. Innerhalb einer Stunde und mit maximal sieben Kilo auf dem Rücken hatten wir die Molkerei zu verlassen, die mein Opa bis dahin geführt hatte. Als wir uns einigermassen in Sachsen eingelebt hatten, starb mein Vater. Das war im Jahr 1954. In diesem schmalen Band der Jahre liegen trotz aller anfänglichen Entbehrungen und Dürftigkeit nochmals meine besten Erinnerungen an meine Kinderzeit. Wir unternahmen recht viel und waren oft unterwegs. Sicher auch, um Essbares zu ergattern. Da waren weite Wege in die Sächsischen Schweiz um Kremplinge zu suchen. Kremplinge waren Pilze, die andere Pilzsucher nicht nahmen, weil sie ein gefächertes Futter hatten und im Übrigen wie Giftpilze aussahen. In den parkähnlichen Wäldern hoch nach Großsedlitz suchten wir im Laubwald nach Eicheln. Sie wurden im Ofen stark erhitzt, verloren so ihren Bitterstoff und gaben einen ganz passablen Pudding ab. Melde und Brennesel gaben feine Gemüse und Suppen, vor allem, wenn sie mit Speck- oder Schinkenaroma aufgepäppelt wurden. Wir waren ja zunächst in einem Zimmer untergebracht, konnten aber ein paar Jahre später umziehen. Da wurden auch die alten Verbindungen zu Verwandten und Bekannten, die bereits vorher aus Schlesien geflohen waren, wieder aufgebaut. Mein Vater war ein sehr lustiger und umgänglicher Mensch, der durch seine offene Art gern gesehen war. Und so war es kein Wunder, dass sich langsam die alten in Deutschland verteilten Bekannten suchten und Verbindung aufnahmen. Ich erinnere mich da an die Familie Klockenbusch, die in Hirschberg gleich neben unserer Wohnung lebte. Besonders in Erinnerung ist mir ein Wellensittich geblieben, der bei ihnen in einem wunderschönen Käfig piepte und herumhüpfte. Ich neckte ihn oft und spielte mit ihm, indem ich den Finger durch die Gitter steckte und er neugierig und vertraulich darauf reagierte. Eines Tages war ich wieder am Käfig und spielte mit ihm, als er plötzlich von der Stange fiel und unten im Käfig regungslos liegen blieb. Furchtbar erschrocken und aufgeregt schrie ich die Familie zusammen. Mutter Klockenbusch besah sich den Vogel eingehend. Dann machte sie einen festen Griff um den Vogel und dieser landete, nachdem sie die Klappe geöffnet hatte, im heftig brennenden Feuer des Küchenofens. Mein gelegentlicher Spielpartner war damit verschwunden. Nun, Reste dieser Familie fanden sich in Thüringen wieder. In der Nähe von Stadtilm, in einem kleinen Dorf mit einem riesigem Charme für einen Jungen wie mich. Man musste mit dem Zug bis in die nächste Hauptstadt schon einmal umsteigen, um dann in den Bus zu wechseln und bis zum Dorf zu kommen. Der kurze Weg zum Dorf führte über eine holprige aufgeschüttete Strasse mit grossen Unebenheiten, die sich bei Regen zu grossen Pfützen aufblähten und in Schlängelwegen umgangen werden mussten. Allerdings kann ich mich an Regen kaum erinnern. Wenn ich dort im Urlaub war, hatte ich fast immer Sonne. Also der kurze Weg führte über eine kleine Brücke. Dann wurde man gleich rechterhand von einem grossen Gebäude begrüsst. Es war eine alte Mühle, in der Korn zu Mehl verarbeitet wurde. Das Interessante war im frei zugänglichen Hof ein mit einem höheren Rand befindlicher grosser Zementtrichter. Er war fest in den Boden eingelassen und lehnte sich an die Hauswand. Wenn man aufpasste, dass sich kein Lastkraftwagen näherte, konnte man in den Trichter hineinsehen und beobachten, wie sich Millionen kleiner Körner einem Sog ergaben, der langsam die Mitte der unaufhörlich bewegenden Masse ansaugte und mit tausendfachem Rinnen einzelner Körner eine unaufhörliche Bewegung erzeugte. Stundenlang konnte ich zusehen, wie sich an den Rändern die kleinen Körner dem Rinnen in die Tiefe entgegenstemmten. Trotz Abwanderung vieler Leidensgenossen klammerten sie sich aneinander, um sich dann plötzlich in einem heftigen, ergebenen Rinnsal überschlagend und rollend hinabzustürzen. Als ich einmal flüchtig in den Trichter sah, bemerkte ich eine Bewegung, die ich sonst nicht wahrnahm. Etwas wuselte ziemlich hektisch in der unteren Mitte umher, kam aber nicht vom Fleck. Beim näheren Hinsehen konnte ich eine Maus erkennen, die immer wieder versuchte, aus dem Zentrum zu kommen und den Rand zu erreichen. Aber die Körner waren ungnädig und stürzten unentwegt in die Mitte des Mahlstromes, wenn sich eine zusätzliche Bewegung ergab. Ich überlegte, wie ich der Maus helfen konnte, aber es waren keine Hilfsmittel in der Nähe und hinabzusteigen war mir viel zu gefährlich. Es blieb aber auch keine Zeit, denn wie verzweifelt die Maus auch rannte, sie wurde in kürzester Frist von den Körnern mitgerissen, verschlungen und verschwand im Strom. Mir war das doppelt unangenehm. Einmal hätte ich der armen Maus gern geholfen. Zum zweiten vermutete ich gleich unter den drehend verschwindenden Körnern ein unerbittliches Mahlwerk, das sowohl die Maus als auch die Körner schleunigst zu Mehl machen würde. Brot ass ich schliesslich auch. Es könnte aus der Mühle kommen. Da half es nur, die Sache schnell zu vergessen. Manchmal war der Trichter völlig leer und gähnte mich unfreundlich an. Doch wenn es eben da nichts zu sehen gab, ging ich weiter. Gleich nach ein paar wenigen Schritten war der Dorfschmied beim Hämmern und beschlug Pferde oder hatte das Schmiedefeuer in Hochform und schlug Funken schlagend auf ein glühendes Stück Eisen ein. Zwischendurch trat er den Blasebalg und war immer in fröhlicher Arbeit. Er war ein stämmiger und kräftiger Mann. Kurz und knapp in seinen Ausdrücken, aber freundlich und verstehend, sodass ein Stadtjunge ewig fasziniert zusehen konnte. Trat man aus der Schmiede heraus, breitete sich ein kleiner Dorfplatz aus, an dem linker Hand als Eckhaus ein kleineres Bauernhaus stand. Das war das Haus, in dem ich mehrere Urlaube verbrachte. Meine Eltern waren hier wohl vorher mit mir einige Male zu kurzen Besuchen gewesen, ich erinnere mich nur schwach. Aber sie fanden sicherlich, dass dies ein Ort und eine Umgebung sei, an der ich mich beschäftigen und mich erholen konnte. Man schickte Kinder damals gern zur Erholung und da ich sehr schlank und schmächtig war, kam ich schon ein paar mal in den Genuss solcher Vorteile. In dem Haus lebte die früher so oft anzutreffende Grossfamilie. Mehrere Generationen und Zweige der Familie arbeiteten, assen und lebten hier gemeinsam. Ursprünglich gehörte das Haus, so glaube ich jedenfalls, dem älteren, dominanten Ehepaar Oma Lina und Opa Hugo. Sie waren beide drahtig schlank und gross und unaufhörlich an der Arbeit. Als letzter der Familie gehörte Hilmar dazu. Er war ein Bruder von Tante Lina, kleiner von Wuchs, ganz ruhig und immer willig bei seinen Aufgaben. Ich mochte ihn sehr. Nicht zuletzt, weil er sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Das kam wohl daher, dass er in seinem Denken und Tun ein wenig behindert war. Wurde im Radio ein bayrisches Lied mit einem Jodler gespielt, liess er meist die Arbeit fahren, sass still in sich gekehrt und liess den Tränen freien lauf. Warum das so war, konnte mir keiner erklären. Ich unterhielt mich oft mit Hilmar. Er war froh, einen Gesprächspartner zu haben und ich hatte alle Gedanken zusammenzunehmen, um sein Thüringisch zu verstehen. Als besondere Worte sind mir “ warummen ” und “ dorthier ” in Erinnerung geblieben. Und es konnte passieren, dass mein Vater, wenn ich aus dem Urlaub zurück kam, mich anmahnte, mein sauberes Hochdeutsch gefälligst hervorzukramen und den Slang und die ulkigen Wortzusammensetzungen aus Thüringen wieder zu vergessen. Es war eine Zeit des freien Stromerns durch Dorf und Natur. Wenn man über die Landstrasse, die das Dorf nur flüchtig tangierte, hinausschaute, sah man einen langen, bewaldeten Hügel. Von ihm konnte man bequem über das Dorf schauen. Ich hatte einen Sattelstein gefunden, den ich mir an einer bequemen Stelle hingelegt hatte. Auf diesem konnte ich sitzen und stundenlang träumen. Herr Klockenbusch konnte mich wahrscheinlich mit ein wenig Mühe von Dorf ausmachen, wenn ich auf meinem Stein sass und nannte mich des öfteren “ Hans, der Träumer ”. Hatte ich es satt, lief ich ein wenig um den Hügel herum, kam zu einem abfallendem Fels- und Geröllfeld. Wenn man in diesem herum stöberte, konnte man Abdrücke urzeitlicher Pflanzen und Tiere finden. Mir gelang es aber nie recht, ein interessantes Exemplar ausfindig zu machen. Sehr viel beobachtete ich einen kleinen Schmetterling, den es in Unzahl gab und den ich in Sachsen nie gesehen hatte. Wie ich erst später in meiner Schule erfuhr, war dies das Blutströpfchen. Der Name war leicht zu erfahren, weil ich mit vieler Mühe ein müdes Tierchen gefangen und aufgespannt hatte und so mit in den Unterricht brachte. Das Exponat landete damals in dem Lehrmittelzimmer, wo sich alle möglichen Ansichtsexemplare von Pflanzen und Tieren, Karten und Bilder tummelten. Ebenso staunte ich über die sehr oft anzutreffende Silberdistel, ein flaches Gewächs mit weissen weit kreisrund ausgestreckten Blütenblättern, die sich wie Strohblumen anfassten. Im Dorf erfuhr ich, wie man sie lagern muss, damit sich die Blüten nicht schlossen. Auch sie habe ich mit nach Sachsen getragen, denn auch hier gab es sie nicht. Auf der anderen Seite des Dorfes konnte man weit in die Felder wandern. Immer gab es etwas Neues zu sehen. Gern trieb ich mich bei den Mohnfeldern herum und füllte meine beiden Hosentaschen prall mit den beliebten Körnchen, um sie auf den weiteren Streifzügen begeistert aufzufuttern. Auf all den Wegen nahm ich stets Greif mit. Er war der Haushund und war ein kräftiger und munterer Schäferhund. Ich verstand mich solange blendend mit ihm, wie er kein Kaninchen ausfindig machen konnte. Denn dann war er ohne Vorwarnung und mit Gebell mit riesigen Sätzen für einige Zeit verschwunden, in der ich ratlos umherstand. Denn Rufen oder Pfeifen, auf das er sonst gut reagierte, hatte keinen Sinn. Eine steinige Dorfstrasse führte weiter hinaus und säumte sich mit Kirschbäumen, die ich gern wilderte, indem ich in den Baum hineinkletterte und nicht zu sehen war. Nur Greif störte mich da, weil er verräterisch bellte und nicht zufrieden war, dass ich nicht bei ihm war. Zu allem Erstaunen kann ich mich sehr viel an alleinige Touren erinnern. Peter war da meist nicht dabei. Möglich, dass er helfen musste oder selbst im Urlaub war. Dagegen kann ich mich gut erinnern, dass wir das Dorf inspizierten oder im durchfliessenden Bach planschten. Dieser ist mir als ein klares, flaches, höchstens vier Meter breites Gewässer in Erinnerung. Er floss träge dahin, trug in kleinen Kolonien Enten und Gänse, die nach Pflanzen zwischen den Steinen stocherten. Meistens suchten wir nach platten Steinen, die wir auf dem Wasser hüpfen liessen, spritzten uns gegenseitig voll, denn es war in der Regel heiss und trocken. Gut kann ich mich auch an die weiter weg spielenden Dorfmädchen erinnern, die - natürlich wenn wir nackt badeten - Peter immer wieder zu sich riefen, um ihm einen Stein zu zeigen oder nach etwas zu fragen. Sie hatten aber immer Kleidung an und ich hielt mich deshalb ein wenig fern. Nicht zuletzt, weil sie immer kicherten und wisperten, wenn sie Peter überredet hatten, doch mal nackt zu ihnen zu kommen. Vorn an der Mühle wurde der Bach gespalten und floss auf der einen Seite in ein schräges grosses Gitter hinein, an dessen Stäben sich Pflanzenreste und angetriebene Holzreste stauten. Aber es staute sich stets nur wenig. Es gab jedenfalls immer etwas zu sehen, etwas zu spielen und wenn es auch nur ein Streit mit den Gänsen auf dem Wasser war, die sich von uns gestört fühlten und uns zischend angriffen. Nicht sehr oft kamen wir in einer grösseren Gruppe zusammen. Es gab nicht viel Jungen Im Dorf, aber manchmal fand man sich zusammen. Gut in Erinnerung ist mir geblieben, dass wir eines Tages auf die breite Wiese zwischen Hauptstrasse und Dorf gingen und die Dorfjungen sich an die Schwänze der dort weidenden Kühe hingen. Diese starteten angstvolle Sätze und kamen in Galopp, während die Dorfjungen, Peter an der Spitze, sich gekonnt balancierend über die Wiese ziehen liessen. Das war mir schon eine Sache, aber so recht traute ich mich nicht, dasselbe auszuprobieren. Zumal sich immer nur zwei das Vergnügen gönnten, während die Anderen das Umfeld sicherten, dass niemand Erwachsenes aus dem Dorf in der Nähe war. Ich musste schon versprechen, kein Wort darüber im Dorf verlauten zu lassen. Einmal war Besuch im Dorf. Ein Junge aus dem Westen war auf ein paar Tage im Ort und wurde eingehend bestaunt. Wir hatten tausend Fragen und er auch. Gut erinnere ich mich, wie wir über die Ostschokolade und den faden Kakao schimpften und er die begehrte Westschokolade mit uns teilte. Als ich aus meinem Fundus, den mir meine Mutter für den Urlaub mit gegeben hatte, eine Tafel Vitalade holte und sie auch verteilte, kamen wir ins Geschäft. Er fand die Vitalade, die für uns eine Mischung aus Mehl und kakaoähnlicher Substanz war, sehr gut. Ich fand dagegen seine Schokoladentafeln wesentlich besser. Und so tauschten wir. Ich fand damals, dass ich ein Bombengeschäft gemacht hatte. Und ich finde das noch heute so. Zum Schlafen hatte ich ein extra Zimmer und ein extra Bett im Haus. Die Inletts waren prall mit feinen Federn gefüllt, weich und kuschelig und ich schlief in der Regel tief und gut bis in den Morgen und zum gemeinsamen Frühstück. Eines Nachts jedoch wurde ich ziemlich unwirsch aus dem Schlaf gerissen. Ob ich denn nichts hören würde. Ja sicher, meinte ich. Das muss ein tolles Gewitter sein, denn es grollte und grummelte, dass die Scheiben zitterten. Aber aufstehen, wie man von mir verlangte und gar noch anziehen, nein, das wollte ich nicht. Es wird schon wieder weggehen, meinte ich und wollte weiter zu schlafen versuchen. Gewitter war nichts, was mich Schrecken konnte. Mein Vater hatte stets, wenn in Heidenau ein Gewitter sich im Elbtal verfing, vom Sofa zwei Kissen geschnappt, die Fenster geöffnet und mit mir aus dem offenen Fenster heraus das Schauspiel verfolgt. Stets hat er mir erklärt, das der Donner eindeutig zeige, das der Blitz schon lange eingeschlagen hat. Wenn überhaupt, wie er betonte. Denn die meisten Blitze gingen von Wolke zu Wolke und würden nichts tun. Ich solle lieber diese tolle Natur bewundern und geniessen. Das taten wir beide, indem wir aus dem Fenster schauten und indem meine Mutter verstimmt und ängstlich sich irgendwo in der Wohnung verkrochen hatte. So kam es, dass ich Gewitter stets gelassen gesehen habe. Nicht so war es in Thüringen. Nicht nur, dass ich mich vollständig anziehen musste, meinen Koffer fix und fertig zu packen hatte, wurde mir auch noch verboten, irgend etwas Metallisches zu berühren. Mein Lachen darüber wurde sehr ungnädig aufgenommen, so dass ich gelangweilt und überlegen das Schauspiel zu Ende gehen liess. In dem Alter sich den Älteren gegenüber bei einer Sache total überlegen zu fühlen, war schon ein innerlich starkes Gefühl. Einmal wurde auf dem Dorfplatz an der Seite der Schmiede und ein Haus danach die Tore einer Scheune geöffnet und eine dort drinnen stationierte Dreschmaschine in Gang gesetzt. Das war ein enormer Lärm und ein enormer Staub und ein wunderbares Geschehen. Stetig rollten grosse und abenteuerlich beladene Pferdewagen an, die Garben von Getreidehalmen anbrachten. Sie wurden mit grossen Gabeln zu einem Bauern geschoben, der sie mit den Körnern zuerst in ein rotierendes und mit einem Blech abgedecktes Schlagwerk schob. Alles Quengeln meinerseits half nichts, er liess mich die Garben nicht in den Reisswolf schieben. Zusehen konnte ich und die Garben zuschieben auch. Mehr wurde nicht gestattet. Da ich meine Chancen auf einen Erfolg als sehr gering einschätzte, fuhr ich mit den leeren Pferdewagen aufs Feld und versuchte mit der Riesengabel Strohfuder mit auf den Wagen zu bugsieren. Aber da waren meine Arme nicht stark genug und man lächelte über den schwachen Stadtjungen. Dafür aber durfte ich mit anderen Jungen die Strohfuder in der Mitte aufbauen helfen. Oder zumindest zureichen, so dass ich langsam und sicher immer mehr an Höhe gewann und schliesslich sehr weit oben auf dem schwankenden Gefährt stand und schon bedenklich nach unten sah. Denn an ein hinabkommen war nicht mehr zu denken. Aber das Abenteuer, auf dem Wagen ins Dorf zu zuckeln und zu schwanken, war fast berauschend. Noch heute höre ich Pferdehufe klappern und das Ächzen des Wagens, wenn ich die Augen schliesse und mich ganz fest erinnere. Auch der kräftige Geruch der Halme und des Korns sind eine bleibende Erinnerung. Meine Wirtsfamilie hatte jedoch mit dem Korn einfahren wenig zu tun. Da waren mehr Arbeiten auf dem Feld, die ich in Erinnerung habe, die mit Rüben und Mangold als Futter für die Haustiere zu hatten, in meiner Erinnerung. Opa Hugo verschnitt Rüben oder grub um. Oder er holte Futter ins Haus. Dabei fällt mir ein, dass alle im Haus Huucho zu ihm sagten und ich mich darüber königlich amüsierte. Denn ich sagte, noch an schlesischem Hochdeutsch geschult, immer Opa Hugo zu ihm. Die Einteilung der Mittagszeit war mir ungewohnt, denn es wurde schon elf Uhr zum Essen gerufen. Das war sicherlich dem frühen Aufstehen geschuldet, mir zwar wegen des späteren Aufstehens ungewohnt. Aber dafür konnte, wer im Haus war, schon um drei Uhr Kaffee trinken. Im Bauernhaus gab es aber auch genügend zu sehen und zu erleben. In der hinten gelegenen Küche war ein kleiner, geziegelter Backofen in der Wand eingelassen und es war für mich brennend interessant, wenn mit Holz angefeuert, ein grosses Glutbett geschaffen wurde und schliesslich die vorher gewalkten und gekneteten Brotlaibe, die ja noch eine geraume Zeit in abgedeckten Holzformen aufgehen mussten, schliesslich in Formen in die Glut geschoben und mit Glut zugeschaufelt gebacken wurden. Es war mir stets ein Rätsel, wie gut Oma Lina die Zeit abpasste und sie ein wunderschön braun gebranntes und duftendes Brot hervorzauberte. Zu späteren Zeiten hatte ich meine Mutter gebeten, ob sie bei Tante Liesbeth nachfragen könnte, ob die hölzernen Brotformen noch in Betrieb seien und der Ofen noch stünde. Aber sie hatten die Küche leider vollkommen renoviert und den wunderschönen, romantischen Ofen entfernt. Dafür konnte ich aber eine hölzerne und recht gut erhaltene Brotform erhalten. Sie hängt heute in unserer Küche und ich kann meinen schönen Erinnerungen nachhängen. Ein weiteres Erlebnis war die mit Hand und oft betriebene Zentrifuge. Sie war schon von mittlerer Grösse, also gut zwischen vierzig und fünfzig Zentimeter in der drehenden hochgeformten Schüssel. Es hatte eine Weile gedauert, bis ich überhaupt begriff, was dieses in höheren Tönen singende und mit einer Handkurbel zu betreibende Gerät für eine Funktion hatte. Aber nachdem ich gesehen hatte, wie frische Ziegenmilch oben in die Schüssel gefüllt wurde und mit kräftigen und langsamen Drehen der Kurbel die Maschine in Betrieb genommen wurde, langsam und stetig in der Drehbewegung steigernd, endlich die Schüssel zu einem enormen Tempo gelangte und so fetten Rahm und dünnere Milch wieder von sich gab, hatte ich eine neue Erfahrung gemacht. Insofern war die Erfahrung auch gravierend, als ich nach meinem Wunsch, auch mal an der Kurbel zu beginnen, recht bald mit schmerzenden Armen mitten im Betrieb aufgeben musste. Schlimmer war das Butterfass. Es war zudem gar kein Butterfass. Es war ein kegelförmiger Behälter. Oben war der Kegel abgeschnitten und mit einem Brett verschlossen. Im Brett war ein mittiges Loch, in dem ein dickerer Holzgriff heraus ragte. Das Brett wurde angehoben, der vorher mit der Zentrifuge getrennte Rahm hineingeschüttet, das Brett wieder eingefügt und mit nicht enden wollenden Kolbenbewegungen wurde der Holzgriff aufwärts gerissen und nieder nieder gestossen. Ging dies im Anfang noch leicht und einfach, wurde mit zunehmendem Betrieb der Kraftaufwand immer höher. Es ging schnell, dass ich kläglich versagte und Oma Lina, sicherlich schon abwartend, die Arbeit übernahm. Am Ende aber kam eine feine Butter auf dem Tisch, frisch und ein wenig scharf nach dem typischen Ziegenaroma schmeckend. Einmal gab es Sonntags zum gemeinsamen Mittagessen, dass immer in der Stube stattfand, eine Überraschung. Schon viele Stunden vorher war die Familie gemeinsam beschäftigt, eine grosse Menge an Bohnen zu zerschnippeln. Eine gewisse Menge wurde für das Mittagessen reserviert. Die anderen wurden eingekocht und sauer eingelegt. Als es zum Mittagessen kam, hieb ich mit kräftigen Löffelstössen in das Essen, denn es schmeckte wunderbar. Allein nach einigen Löffeln voll Bohnen hielt ich ein und schaute genauer auf meinen vollen Teller. Oben auf der wunderschönen Mahlzeit schwamm eine Unmenge bewegungsloser Ameisen. Jetzt hatte ich erst einmal eine Weile damit zu tun, auf die anderen Teller zu schielen und nachzusehen, ob der Zustand dort auch so war. Er war auch so. Nun zögerte ich, was ich denn unternehmen könnte, um aus der mir peinlichen Situation heraus zu kommen. Einfach die Wahrheit heraus zu trompeten war mir nach dem Arbeitsaufwand, den ich ja mit angenehmeren Zeitvertreib umgangen hatte, zu unangenehm. Allein, man hatte mein Zaudern schon bemerkt und ich konnte mit der Beobachtung nicht mehr hinter dem Berg halten. Man lachte allgemein und las und schöpfte die Ameisen aus dem Essen. Dann löffelte man allerseits unbeirrt weiter. Jeder hatte nur die Frage, was Ameisen in Körben und Töpfen mit Bohnen zu suchen hatten und wie sie da hineinkamen. Mir war das egal. Ich mochte nicht weiter essen. Aber man lachte mich aus und ich wartete bis drei Uhr. Denn dann gab es Kaffee und Kuchen. Und da hieb ich eben etwas mehr ein. Zwischen den Zeiten, wenn der Hund döste, niemand zum Spiel aufzutreiben war und ich keine Lust hatte, etwas zu unternehmen, unterhielt ich mich mit Herrn Klockenbusch. Da waren einige wenige Erinnerungen an die Zeit in Schlesien und an Hirschberg. Und wie ich als kleiner Junge unablässig mit der Strassenbahn durch die Stadt fahren wollte. Die Erinnerung war lückenhaft, denn ich war damals gerade vier, fünf Jahre alt. Deshalb ging es in unseren Gesprächen auch um Gott und die Welt und die Ansichten darüber. Von meinem Vater hatte ich viele Meinungen übernommen und konnte vieles darüber berichten. Wir stritten um die Konsequenz meines Vaters, ob es richtig sei, in keinem Volkseigenem Betrieb arbeiten zu wollen und die Politik der Roten, wie mein Vater immer schimpfte, rigoros abzulehnen. Wer hinter die Sache sehe, meinte er, merke bald, dass zwischen den Bonzen braun und rot kein Unterschied sei und in den Kreis begebe er sich nicht. Auch die Weltanschauung war ein Thema. Und ich verteidigte den Standpunkt meines Vaters, der sich von niemanden sein Verhältnis zu Gott vorschreiben lassen wollte. Er war nicht in der Kirche und meinte stets, jeder müsse sein Verhältnis zu ihm selbst klären. Das stiess bei Herrn Klockenbusch als christlichen Menschen schon auf Wiederspruch. So hatten wir Themen über Themen und es gab nie langweilige Gespräche, sondern auch eine Menge an Lebensweisheiten, die ich gern aufnahm. Eines Tages, als wir sicherlich wieder unsere Ansichten getauscht und tiefschürfend miteinander geredet hatten, sagte er zu mir: Wenn du einmal älter bist und dich an das Gespräch hier erinnerst, dann wirst du sagen: Der alte Mann damals in Thüringen, der mir das erzählt hat, der hat Recht gehabt. Ich erinnere mich auch noch daran. Und ich sehe ihn auch noch vor mir. Aber was er zu mir gesagt hat, das habe ich unterdessen vergessen. zum Anfang der Geschichte 18. Nu, das ist Moment - oder: Bekloppte Russen eben Bei Robotron zu arbeiten und zu glauben, dass man an der Front der technischen Entwicklung in der Welt steht, war der eine Irrtum. Zu glauben, dass die Forschungsarbeiten die alleinige Priorität hätten, war der andere. Sicherlich hatten einige der technischen Doktoren in den Forschungsabteilungen gewisse Freiräume, um die Ideengewinnung und die Findung von Patenten voranzubringen. Aber auf Schritt und Tritt wurde sozialistisches Bewusstsein gefordert. Insofern ist es aus meiner Sicht schon in Ordnung, wenn der Staat eine hohe Loyalität von den Mitarbeitern forderte und sie dafür gut versorgte. Andererseits sollte man die Forschenden in Ruhe ihre Neuheiten entdecken lassen und nicht so viel mit niedrig angesiedelter Politik belästigen. Bei Robotron belästigte man die Leute. Die gut viertausend Mitarbeiter im Atrium waren fast allesamt in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, kurz DSF genannt. Das war sozusagen Pflicht. Wenn man nicht wollte, wurde man von einem der Vorgesetzten oder einer Gruppe ins Gebet genommen. Wer nicht Mitglied werden wollte, war gegen die Sowjetunion und damit gegen den Frieden. Es galt sich also rhetorisch zu wehren. Wenn ich mich recht erinnere, zahlte man dafür einen Beitrag ab 50 Pfennige pro Monat. Das war keine Summe, die irgend jemanden belastet hätte, obwohl die damaligen Verdienste niedrig waren. So verdiente ich um die siebenhundert Mark monatlich. Damit zählte ich aber im allgemeinen Umfeld meiner Bekannten nicht gerade zu den denjenigen, die gering verdienten. Rechnet man die viertausend Beschäftigten nur mal mit den fünfzig Pfennigen zusammen, kommt man auf eine Summe von 2000 Mark pro Monat. Das ist auch keine Summe, mit der man riesige Sprünge machen kann. Das hat mich auch nicht gestört. Anstoss habe ich jedoch genommen, was mit der Summe unternommen wurde. Denn die Ausgaben waren aus meiner Sicht gering. Sowohl die Partei - und mit dem Ausdruck meinte man immer die SED, die sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz die Roten oder die Kommunisten, jedenfalls die, die in der DDR das sagen hatten - waren nahtlos im Betriebsgeschehen eingebunden und brauchten reineweg nichts. Schreibmaschinen, Papier, Arbeitszeit, alles war kostenfrei. Denn es wurde mitten im Betriebsablauf geleistet, war eingebunden und wurde nicht gesondert abgerechnet. Schon aus diesem Grund forderten wir später im Neuen Forum - der Gruppe, die die Wende richtunggebend beeinflusste - dass das so genannte Parteivermögen der SED gegen diese Leistungen gegengerechnet werden müsste. Unsere Forderungen verhallten. Bei den Ossis, weil die einen eigene Interessen verfolgten und von ihren alten Netzwerken lebten und weil die anderen, die Wessis, sich diese die Abläufe einfach nicht vorstellen konnten. Kommen wir zu den Einnahmen der DSF zurück. Veranstaltungen wurden nach meinen Erfahrungen nur durchgeführt, wenn es um politische Schulungen ging. Da wurden sowjetische Arbeitsmethoden angepriesen und gelobt. In Erinnerung sind mir nur die Nina-Nasarowa- und die Bassow-Methode geblieben, in der man wohl bei Letzterer vor der Arbeit sein Werkzeug so zusammenstellen sollte, dass man für die gerade vorgenommene Arbeit alles griffbereit zur Hand hatte. Es konnte aber auch anders herum gewesen sein. So gab es wohl bis zu fünf verschiedene russische Methoden, die die Arbeit forcieren sollten und uns als Vorbild eingeredet wurden. Ebenso wurden uns die sowjetischen Menschen als bewusste Vorbilder mit bester sozialistischer Arbeitsmoral vorgehalten. Und die Arbeit nach diesen Methoden sollte auch noch abgerechnet werden. Ich fand das geradezu lächerlich, wenn nicht geradezu schwachsinnig. Wenn ich am Anfang davon sprach, dass fast alle in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft waren, meinte ich, das es zwei Mitarbeiter im Atrium gab, die sich dem versagten. Der eine war Bernd, den ich aus der Patentabteilung kannte. Ein einbeiniger Sportlertyp, der ebenso rasant wie wir alle Rad fuhr und im Stand, mit genügend Schwung zu nehmen, auf den Tisch springen konnte. Ihn liess man in Ruhe, denn die russischen Soldaten hatten ihm als Kind aus lauter Willkür das Bein abgeschossen. Da war nichts mit Hass, aber auch nichts mit Freundschaft. Der andere, der sich permanent gegen die Mitgliedschaft sträubte, der war ich. Meine Begründung lag auf anderer Ebene. Gegen Freundschaft und Erfahrungsaustausch hatte ich nicht das Geringste einzuwenden. Aber wohl dagegen, das es rein statisch zugehen sollte. Ich propagierte deshalb die Deutsch-Ungarische-Freundschaft, schon weil ich mit etlichen Budapestern nähere Kontakte unterhielt. Sowohl mit Briefen, als auch mit gegenseitigen Besuchen. Das war mit Sowjetbürgern nicht möglich. Man bekam niemanden zu sehen, keine Adressen in die Hand und keine Urlaubsziele genannt, bei denen man sich treffen und austauschen konnte. Es war ein reines Phantom, das man verehren sollte und das war mir zu suspekt. Ich empfand es eigentlich als eine bodenlose Frechheit. Dazu war ich vollends wütend, weil mich nach vielen anderen Gesprächen mit den Leitenden aller Ebenen auch noch ganz gewöhnliche Mitarbeiter angingen, was ich denn gegen die Sowjetmenschen hätte und ich meinen Widerstand mit der Logik eines gegenseitigen Austausches einfach nicht zum Verständnis bringen konnte. Es wurde zur Bewusstseinsfrage stilisiert und ich hatte alles zu tun, das abzuwehren. Dafür durfte ich, als gelernter Mann der analogen Technik eines Tages die Anlage zur Beschallung des Speisesaales testen und einstellen, weil ein Besuch aus der Sowjetunion im Rahmen der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft angekündigt worden war. Die Vorbereitungen waren ganz erheblich und ich denke schon, dass dazu auch die Mittel der Gesellschaft verwendet wurden, wenn sie denn nicht zentral an die oberen Behörden in Berlin gehen mussten oder der Betrieb darauf sitzen blieb. Natürlich bewarben sich einige, die Mitglied waren und mit denen ich guten Kontakt hatte, um eine Teilnahme. Aber das blieb nur den oberen Chargen, also den Bonzen vorbehalten. Da war die Empörung zwar gelinde, aber unter vorgehaltener Hand war die Meinung klar: Die Versaufen unsere Mitgliedsbeiträge. Noch schlimmer war die Erfahrung, als ich am nächsten Tag die Anlage zur Beschallung wieder abräumen und die Mikrofone verstauen sollte. Das Essen war nach russischem Muster verlaufen. Das heisst, dass die meisten Speisen und Teller auf dem Tisch verblieben und nicht abgeräumt wurden, damit man während des Wodka-Trinkens immer den Pegel mit etwas Essen zwischendurch stabilisieren konnte. Nach dem zurück gelassenen Durcheinander zu urteilen, musste es ein kräftiges Besäufnis gewesen sein. Es sah wüst aus. Dass ich den Raum schon früh zur Unzeit betreten konnte, lag sicherlich daran, dass ich mich neugierig beeilte, um zeitig in den Saal kommen und die Anderen, die teilgenommen hatten, noch nicht in der Lage waren, zu erscheinen. Umgeschüttete Gläser und verschüttete Speisen, aufeinander gestapelte, noch nicht abgegessene Teller und ein Durcheinander ergaben ein schlimmes Bild. Wenn man sich betrinkt, sieht es sicher immer nicht gut danach aus. Aber hier ging es doch eigentlich nicht ums Saufen, sondern um die sozialistische Moral, den Erfahrungsaustausch und „ die Stärkung des Sozialismus “. Ich habe auch von den Ergebnissen der Tagung nichts gehört und die Mitglieder erst recht nicht. Allgemeiner Unmut war das Ergebnis. Meine Bemühungen, einmal eine Reise in die Sowjetunion zu erhalten und zu erkunden, wie denn dort die Dinge lagen, kamen um keinen Deut vorwärts. Dafür konnte ich Erzählungen von einigen Dienstreisen aufschnappen und was die Reisenden dort erlebten. Das war nicht sonderlich erbaulich. Da wurde erzählt, dass sich die Bürger in den einzelnen Sowjetrepubliken keineswegs persönlich austauschen konnten. Reisen in eine andere Region mussten beantragt und begründet werden und Briefe waren nicht möglich. Individuelle Reisen per Auto für Ausländer waren gleich ganz unerwünscht und waren nur auf festgelegten Routen möglich. Ein Abweichen vom vorgegebenen Weg war verboten. Wenn man sich verfuhr, so wurde erzählt, wurde man in kurzer Zeit vom Milizionären auf Motorrädern gestoppt, ermahnt und zur vorgeschriebenen Fahrtroute zurück gebracht. Das hielt mich nicht ab, zum Ende der achtziger Jahre, nachdem ich alle Ostblockländer besucht hatte, einen Weg zu suchen, um auch die Sowjetunion, wir sagten immer kurz SU, zu befahren. Zu der Zeit gab es Wirtschaftsprobleme ernsthafteren Charakters und die Grenzen nach Polen wurden abgeriegelt. Ich hatte mich auf das Reisebüro in der Wilsdruffer Strasse in Dresden begeben und suchte mir eine besonders nette und junge Vermittlerin aus. Der schilderte ich, dass ich beste Kontakte zu Polen hätte, ja auch dort geboren sei – aber damals in Schlesien - und nun gern nach Polen oder noch besser in die SU mit dem Auto reisen möchte und ob es nicht doch einen Weg gäbe. Es gab zunächst nur einige feste Buchungen in Hotels, diese aber auch nur sehr knapp und natürlich nicht mit individueller Anreise per Auto. Aber, versprach sie mir, sie wolle mal sehen, was da möglich sei. Ein paar Mal kam ich umsonst zur Nachfrage und einige Kollegen, denen ich mein Wollen anvertraut hatte, prophezeiten mir gleich die volle Absage. Ich glaubte auch an einen Misserfolg. Das war aber noch nie ein Grund für mich gewesen, es nicht trotzdem mit allen Mittel zu versuchen. Eines Tages jedoch lächelte sie mir schon von weitem kurz zu. Und nachdem sie die vor mir stehenden Leute abgefertigt hatte, sagte sie, dass sie doch etwas ausgegraben hätte, das mir sicher zusagen würde. Also, ich könnte mit dem Auto über Görlitz nach Polen einreisen. Von dort könnte ich über Przemysl in die Moldauische Sowjetrepublik einreisen und über zwei Städte, die zweite ist mir mit Namen Kishinow in Erinnerung, durch die SU fahren, um dann in oberen Rand von Rumänien einzuschwenken und über die CSSR (das war die Tschechoslowakische Volksrepublik) wieder in die DDR einzureisen. Das besondere an dieser Reise sei, pries sie ihr Angebot, dass ich mit meinem Visum – man brauchte immer eines, ausser später in die CSSR - an keine Zeit gebunden sei. Ich könnte mich also beliebig in Polen bewegen und aufhalten und herum fahren, wie ich Lust hätte. Ja sogar mit kurzem Bogen über die CSSR zurück in die DDR kommen könnte. Das war mir natürlich neu, solche Freiheiten zu erhalten. Nur die Route in der SU war mir vorgeschrieben, aber die Zeitfolge nicht. Ich war begeistert und versuchte natürlich, ob ich diese Route nicht bis zum Schwarzen Meer und Odessa ausdehnen könnte. Aber das ging natürlich nicht. Und so legte ich die Route fest, zunächst ein wenig den Urlaub mit dem Campingwagen – es war der Klappfix, ein flacher Hänger, der mit Zeltgestänge zu einem grossen Zelt aufgefaltet wurde und unter einer extra Überdachung stehen konnte, wenn man sich die dazu besorgte - in Polen zu verbringen. Dann legte ich die weitere Route durch die SU fest und bestellte die entsprechenden Voucher, denn dort durfte ich keinen Zeltplatz buchen, sondern musste im Hotel übernachten. Mit zwei angepeilten Orten glaubte ich auszukommen, um dann den Bogen nach Rumänien zu schaffen. Die Reise begann recht wild, indem mir ein Pole in der Nähe von Oppeln (Opole) bedeutete, dass mein Bremslicht nicht funktionieren würde. Mein damaliger Personenkraftwagen war ein Wartburg aus der DDR-Produktion und ich war aufgrund des permanenten Ersatzteilmangels recht gut mit ihm vertraut. Lange brauchte ich nicht zu suchen, um den Fehler zu finden. Am Bremsschalter war ein Kontakt so kurz abgebrochen, dass der Steckkontakt nicht mehr greifen konnte und in der Luft hing. Als zünftiger Autotourist aus der DDR hatte ich in der Regel immer recht viel an Ersatzteilen mit. Natürlich eingerechnet, dass man sie auch zu kaufen bekam. Diesen Schalter hatte ich jedoch nicht. Also befestigte ich die beiden Steckkontakte provisorisch, verband sie mit isoliertem Draht und zog diesen vorher verdrillten durch den Motorraum bis in den Fahrraum. Dort befestigte ich die beiden abisolierten Enden am Lenkrad so, dass ich ohne grosse Mühe während der Fahrt die beiden Drähte mit einem geschicktem Griff verbinden konnte: Schon leuchtete das Bremslicht und ich brauchte nur noch zu bremsen. Das klingt abenteuerlich. Aber Ähnliches war an der Tagesordnung. Ich erinnere mich an die Zeitung “Der Kraftverkehr”. In ihr wurde besonders zur Urlaubszeit immer wieder publiziert, wie sich Autotouristen bei komplizierten Fehlern selbst halfen und welche Ersatzteile man tunlichst mitnehmen sollte. Beim Wartburg waren dies zum Beispiel ein Kupplungsseil und Dichtungen für die Benzinpumpe. Ich hatte sogar einen Antrieb für das Vorderrad mit. Der Wartburg wurde durch die Vorderachsen angetrieben und beide Seiten waren identisch. Noch heute amüsiert mich die Erinnerung an einen Bericht aus der zitierten Zeitung aus dem Urlaubsziel Rumänien. In ihm wurde geschildert, wie sich eine kleine Gruppe Camper überlegte, wie einem Havaristen zu helfen sei. Ihm hatte sich bei dem Dreizylinder-Motor seines Wartburgs ein Zylinder festgefressen. Ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung, aber jedenfalls wurde dieser abgeklemmt, mit einer Blechbüchse verschlossen, so dass der Havarist mit zwei Zylindern und mit Zittern und Zagen und einem kräftigem Benzinverbrauch bis Nachhause kam. Der Motor war hin, aber er hatte es geschafft. Ein 1.April-Bericht wird es wohl nicht gewesen sein. In Rumänien war es so, dass man sich - war man als Autocamper unterwegs - gegen Abend einen Platz suchte, an dem sich recht viele DDR-Touristen zusammenfanden. Einmal war es ein Schutz zur eigenen Sicherheit und ein andermal ein Plausch zum Austausch von Erfahrungen. Campingplätze waren nicht überall zu finden und so kampierte man eben an Plätzen, die schon andere benutzt hatten. Dann sass man beisammen und tauschte Erlebnisse, Erinnerungen aus, gab Ratschläge und half sich bei Problemen wie hier geschildert. Ich erinnere mich an einen Platz mit einem Bach und einem lang liegendem trockenen und kräftigem Baumstamm. Irgendjemand hatte ein Ende davon zum Brennen gebracht und als wir ankamen, war ungefähr ein Drittel des mächtigen Stammes verglüht. Rauchwölkchen stiegen auf und ein gemächliches Flämmchen loderte verhalten. Mit ein bisschen Wedeln konnte man ein solches Feuerchen entfachen, dass es reichte, die aufgespiesste Wurst zu grillen, etwas zu trinken und mit anderen angenehm zu plauschen. Noch war ich aber in Polen und hatte ein Problem. Ich brauchte Strom für einen Lötkolben, mit dem ich den Steckkontakt anlöten könnte. Den Lötkolben hatte ich natürlich mit. Wir waren zudem nah an der russischen Grenze und ein weiter Weg lag noch vor uns. Nun drängte es, denn der Zeitplan war auf der russischen Seite strikt einzuhalten. Zwar funktionierte der Bremsablauf bei vorausschauender Fahrweise hervorragend, aber manchmal wollten die Drähtchen doch nicht ganz so und klemmten erst zusammen, als ich schon bremsen musste. Es war umständlich. Also machten wir uns auf die Suche nach einer Werkstatt. Aber wir hatten wohl die Orientierung über die Wochentage verloren, denn die wenigen Werkstätten waren allesamt geschlossen und es war sicherlich Sonnabend oder Sonntag. Dennoch machte ich mich an einem ungefähr zwei Meter hohem Drahtzaun und einem rasend wütenden Schäferhund dahinter bemerkbar. Das heisst, dass ich den kläffenden Hund als Klingel benutzte und einfach knapp vor dem Zaun stehen blieb. Der Hund gab auch keine Ruhe und bald kam aus dem hinteren Gebäude ein kräftiger, dicker unrasierter Pole gemächlich zum Vorschein. Er liess sich auf keine Erklärungen von mir ein, sondern schnauzte den Hund an, ruhig zu sein und schob den meterhohen Zaun an einer Seite auseinander und bedeutete mir, in den Hof zu fahren. Es war richtig, eine Autowerkstatt. Kaum war ich hereingefahren, schob er den meterhohen Zaun wieder zu und wir waren im wahrsten Sinne des Wortes gefangen. Auch reagierte der Hund sehr aufmerksam auf jede unserer Bewegungen. Also mussten wir uns an einen abgesägten tischhohen Baumstumpf setzen, schon hatte er eine Flasche mit Schnaps und Gläsern dabei und es gab erst einmal einen Schluck zur Begrüssung. Dann liess er sich das Problem schildern und ich wollte meinen Lötkolben holen. Allein, er winkte mir ab. Gemeinsam besahen wir den Schaden, besprachen kurz die Ausführung und dann musste ich mich wieder an den Baumstumpf zu meiner Frau setzen. Unter Aufsicht des Hundes blieben wir sitzen, während er einen Lötkolben holte und in aller Seelenruhe die abgebrochene Klemme wieder anlötete. Erst als er fertig war, durfte ich das Werk begutachten. Es war sauber gearbeitet, aber die Klemme so ungünstig angelötet, dass sie sich eventuell unter Zuglast wieder lösen konnte. Als ich das bemängelte, machte er sich wieder unverdrossen an die Arbeit und befestigte den Anschluss diesmal vorbildlich. Das war natürlich sofort wieder einen gemeinsamen Schnaps wert. Ich hatte aber auch ein Problem. Erstens wollte ich die Arbeit selbst vollbringen, um die Qualität abzusichern. Das war jedoch in Ordnung. Zum zweiten hatten wir nicht genügend Geld bei uns, da der Umtausch limitiert war. Wenn der Pole einen hohen Preis verlangte, hatte ich ein Problem: Ich hatte kein Geld mehr in seiner Währung. Aber das Problem war keines. Er konnte ein gutes Deutsch, war auch zu Geschäften eher mal in der DDR gewesen und kannte alle Beschwerlichkeiten. Wir sollten, meinte er, einen ordentlichen Schwatz halten und etwas politisieren, noch etwas trinken und dann wäre alles geregelt. Als wir keine Ruhe gaben, liess er sich unsere Adresse geben und meinte, dann käme er uns eben irgend wann einmal besuchen. Er hat es aber nie getan. Wir waren froh, den Ausfall behoben zu haben und zogen uns an den grenznahen und ziemlich vollen Campingplatz zurück. Sicher auch durch den genossenen Schnaps schliefen wir sehr fest, wachten aber am zeitigen Morgen auf. Der Campingplatz war so gut wie leer. Die Polen waren mit ihren Zelten und Autos verschwunden. Die Verbliebenen bedeutenden auf unsere Nachfrage eine Handbewegung in Richtung Osten an und sagten: “ Granitza “ - Grenze. Es beeindruckte uns nicht, die Sachen waren schnell gepackt, das Zelt zusammengeklappt, im flachen Anhänger eingefaltet, und los ging es in Richtung Sowjetunion. Es war ja noch sehr früh. Wir hatten noch nicht einmal ein eindeutiges Schild für die Grenze ausmachen können, als uns eine eigenartige Autoschlange zum Halten zwang. Das Land war flach und weit einzusehen. So konnten wir eine unendlich lange und gewundene Schlange an Fahrzeugen ausmachen, alles Personenkraftwagen und alle in Richtung Osten, kaum ein Fahrzeug kam uns entgegen. An den Autos standen die Insassen, manche putzten sich die Zähne am Strassengraben, andere rasierten sich und alle machten auf irgend eine Art Morgentoilette. Wir waren baff. Schliesslich fragten wir. Alle wollten an die Grenze und hinüber in die SU. Auf unsere Nachfrage, wie lange denn die Wartezeit sei, gab man uns eine erschreckende Antwort: Etwa 24 Stunden. Nachdem wir uns noch einmal vergewissert und alle die Umstände um uns herum analysiert hatten, kamen wir zu dem Schluss: Die veralbern uns nicht. Kurz entschlossen stiegen wir in unser Gespann, blinkten links und fuhren an der Schlange einfach entlang. Keiner hinderte uns, keiner schaute erstaunt, alles war normal. Bis wir schliesslich, aber noch lange nicht am Ende der Schlange, von einem polnischen, mürrischen Grenzbeamten aufgehalten wurden. Ihn interessierte nicht, dass wir einen Voucher und entsprechendes Papier hatten, um noch heute die Grenze zu passieren zu sollen, ja passieren zu müssen. Er kannte nur eine Bewegung und ein Wort. Beide drückten das gleiche aus: “ Zurück“. Und das schnell. Nun drehen Sie mal mit einem Hänger auf einer Strasse um, bei der die rechte Fahrbahn ununterbrochen besetzt ist. Und machen Sie eine Reise, bei der die Zeit vorgegeben ist und die Repräsentanten der Grenze es nicht interessiert, ob sie unpünktlich sind und die Reise hinfällig wird. Bei so viel Desinteresse und so viel Unfreundlichkeit und Unverbindlichkeit schwillt mir im Normalfall stets der Kamm und ich kann laut und unsachlich werden. Genau das machte ich nicht, sondern wir warteten, bis der unfreundliche Beamte einen Landsmann am Wickel hatte und dort beschäftigt war. Dann gab ich einfach Gas und fuhr schnell vorbei und weiter. So kamen wir an eine Kurve, an der auf der linken Seite ein Stein war, auf dem ein anders Uniformierter sass, der uns ungerührt, aber interessiert entgegenblickte. Sein dekorierter Anzug und sein bedeutsames Dasitzen gaben uns den Hinweis, hier lieber anzuhalten und möglichst freundlich nachzufragen. Er liess sich mit Gestikulieren, Unterlagen vorzeigen und ein wenig Russisch informieren und winkte uns dann gnädig und verständnisvoll weiter zur Grenze, wo wir uns ganz vorn einfach in die Reihe drängelten. Das Bild war bedrückend. Überall geöffnete Kofferklappen und Türen, aufgescheuchte Menschen, Fuchteln, Weinen und Schimpfen. Uns beachtete keiner. Wir huschten an die Spitze und kamen in die Kontrolle. Sehr oft schienen Urlauber unseres Kalibers nicht über die Grenze zu kommen, denn von Seiten der Grenzer genossen wir eine ganz andere Beachtung. Freundlich wurden wir auf eine Grube gewunken und einlanciert. Dann kamen Grenzer mit langen, starren Drähten, die an den Fenstern der Seitentüren hinunterfuhren, um zu prüfen, ob die Türfüllungen leer waren. Unter dem Auto liefen Andere entlang und kontrollierten die Unterseite des Autos, drückten dort und schauten da. Schliesslich mussten wir unseren flachen Campingwagen öffnen und die Klappe anheben. Auch da schaute einer forschend hinein. Als er unsere sehr erstaunten und verdutzten Gesichter wahrnahm, drehte er sich uns zu und fragte: “ Nu, wo ist Partisan?” Das löste die Spannung und mit ein wenig radebrechen konnten wir erzählen, was wir vorhatten. Gleich darauf bekamen wir grünes Licht und konnten losbrausen, um verlorene Zeit einzuholen. Das dachte ich jedenfalls. Mit Brausen war freilich nichts. Die Strasse war geschottert, breit, mit vielen Steinen und beachtlichen Löchern zwischendurch, die irgendwann unlogisch auftauchten, wenn man gerade erleichtert etwas auf Tempo fahren wollte. Dann tauchten kleine Städtchen auf, in denen die Leutchen ungerührt auf der Strasse liefen oder Fuhrwerke versperrten in aller Gemütsruhe das Weiterkommen und zu guter Letz mussten wir geduldig hinter einer Prozession einhertuckeln, aus der mit vorangetragenem Kreuz traurige Lieder klangen und der mit einem ebenso traurigen Trott die Strasse lange Zeit blockierte. Wir schlichen mäßig vorwärts und kamen zusehend mit der Zeit in Verzug. Es wurde später Nachmittag und wir wollten schon am Ziel sein. So recht konnte man sich auch nicht orientieren und überholende Milizionäre auf Motorrädern wollten wir nicht anhalten. Uns beachtete jedenfalls kaum einer. Gewiss, interessierende Blicke, sicherlich ob des etwas ungewohnten Anblicks, gab es, aber sonst war jeder mit sich selbst beschäftigt und wenn wir einmal etwas ungeschickt und suchend die Strasse blockierten, gab es gleich ein unnachgiebiges Hupkonzert. Wir konstatierten: Ein unhöfliches Volk, schnell weiter. Bereits jetzt schmerzten mir die Arme vom anstrengenden Lenken. Die Dunkelheit kam über uns. Wir waren immer noch nicht am Ziel. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, suchten wir den Ort Cernovzy und dort ein vorgeschriebenes Hotel. Wir kamen endlich kurz vor zehn Uhr abends an. Uns empfing ein lauter Trubel in den unteren Hotelräumen. Es war ein Haus mit schweren Teppichen und düsterem Flair vergangenen Wohlstandes vor dem Kriege. Auf jeder Etage begrüsste uns eine Babuschka (eine alte Dame in altbarocker Kleidung), die vor einem dampfenden Samowar sass. Hielt sie Wache, oder stand sie für Dienstleistungen bereit? Wir wussten es nicht. Wir konnten unsere Zimmer aufsuchen und trugen unser Gepäck hinauf. Betreffs des Essens konnte uns Babuschka keine Antwort geben. Sie wies uns in die unteren Räume. Dort ging es lustig und laut zu. Es wurde getanzt und gelacht und getrunken. Die Teller stapelten sich noch auf den Tischen und zeugten vom verzehrten Abendbrot. In unserem Voucher war für jeden ein Abendbrot im Hotel enthalten. Also versuchten wir zu bestellen, erhielten aber eine abschlägige Antwort. Njet, nein, nichts mehr, zu spät. Nun habe ich vergessen zu erzählen, dass unter dem Begriff “ Wir “ vier Personen versteckt waren. Unser Jüngster, Oliver, war etwa gerade fünf Jahre alt. Sofie, unsere Tochter, damit vierzehn, meine Frau Jo zweiunddreissig und ich vierunddreissig Jahre alt. Es müsste demnach 1974 gewesen sein. Also diese vier postierte ich im Gänsemarsch, setzte mich an die Spitze und marschierte spornstreichs in die noch erkennbar besetzte Küche. Dort schob ich die beiden Kinder vor und erläuterte, dass ich zwar sehr verspätet sei, aber im Besitz von vier bestätigten Gutscheinen für Essen in diesem Hotel und das wir alle grossen Hunger hätten. Natürlich hatten wir Verpflegung mit, aber ich war der Meinung, bezahlt sei bezahlt und Touristen sollte man freundlich und nachsichtig bedienen. Das alles wurde in einer Mischung von Russisch, Gestikulation und Beschwörung vorgetragen. Es hatte Erfolg. Mit diesem Auftritt hatten wir sicher etwas Furore gemacht und Aufmerksamkeit errungen, denn kaum standen die Getränke auf dem Tisch, wurde Jo, meine Frau, schon zu einem Tanz aufgefordert. Nun bin ich nicht ganz sicher, ob sie aus etwas Angst oder weil ich ein genereller Tanzmuffel war zustimmte, jedenfalls drehte sie erst eine Runde, bevor das Essen kam. Das Menü ist mir nicht sonderlich in Erinnerung geblieben. Es wird verdeckt von einem Geruch, dem wir misstrauisch entgegen schnupperten. Es waren gebratene Beefsteaks auf dem Teller, die etwas eigenartig rochen, etwa wie Fleisch, das ein wenig angegangen, in der Hitze überlagert oder leicht dabei war, schlecht zu werden. Wir diskutierten, schauten auf die noch zurückgelassenen Teller, wo Reste dergleichen Art erkennbar waren und einigten uns schliesslich, das dass, was die Russen vertragen, wir schon lange vertragen und wenn es sein sollte, eben mit einem kleinen Schluck Wodka. Ausserdem waren die anderen putzmunter und tanzten fröhlich. Also assen wir nicht übermässig viel, liessen ein wenig vom Fleisch übrig, waren aber dann satt. Am nächsten Tag machten wir uns aus der Erfahrung des Vortages zur erlebten Fahrstrecke zeitig auf die Spur. Von der Landschaft ist mir auch wenig in Erinnerung geblieben. Es schien alles grau in grau und bestäubt vom Staub der Strasse. Stets hatten wir bei allen anderen Urlauben versucht, nicht nur das Land kennen zu lernen, sondern auch die Leute dazu. Das war hier mit Hotelaufenthalten ein wenig schwierig. Übrigens konnten wir keinerlei Campingplätze ausmachen und fuhren hochkonzentriert dem nächsten Ziel zu. Ein Hotel in Tschernovcy, schon nahe an der Grenze nach Rumänien. Wir kamen an und uns begrüsste diesmal ein etwas modernerer Bau, ein weite Halle, ein Empfangstresen und, ich nahm es sofort war, Spielautomaten mit Cola-Werbung und amerikanischer Flagge. Nichts Besonderes heute, aber zur damaligen Zeit in der DDR undenkbar, überhaupt nicht vorzustellen und geradezu gefährlich. Und hier, im Urland des Sozialismus, stand so etwas herum. Nun, wir warteten am Empfang und belauschten zwei kräftige blonde Damen, die, offensichtlich als Personal kenntlich, intensiv miteinander schnatterten, ohne einen Blick auf uns zu werfen, ja, nicht mal uns wahrzunehmen. Auf ein mehrmaliges Räuspern reagierten sie auch nicht. Ich hob meinen Arm, ballte die Faust und liess sie auf den Tresen sausen. Das Paar war freilich nicht sonderlich erstaunt, trennte sich aber sofort und wir wurden in unsere Zimmer eingewiesen. So wäre alles schön und gut gewesen, hätte ich nicht am Vortag schon wieder ein Problem am Auto gewittert. Manchmal wollte bei einem Halt unterwegs der Motor nicht willig anspringen. So ging ich die Sache kontrollieren. Das Fahrzeug war in einem Parkplatz, einem umzäunten, schrägen Gelände abgestellt und ich hatte es mit einer unterschwelligen Ahnung so plaziert, dass man es notfalls mit ein wenig Mühe auch anschieben konnte. Nach einigen Versuchen bestätigte sich das Problem: Der Anlasse drehte sich nicht mehr. Im Hotel erklärte ich mein Problem: Das Auto springt nicht an, ich brauche eine Werkstatt und ich brauche eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer im Land. Das Letztere schien ein unüberwindliches Hindernis zu werden. Ob die Damen, wie von mir gefordert, die Botschaft anriefen und wen sie in Bewegung setzten, war mir nicht möglich zu kontrollieren. Schnell gesprochenes Russisch und sicher noch in einem Dialekt konnte ich nicht einmal in Wortfetzen verstehen. Es wurde offensichtlich mit mehreren Stellen telefoniert. Ich hatte jedenfalls auf Biegen und Brechen am nächsten Tag die Sowjetunion zu verlassen. Die Sache sah ich gelassen. Mich würde man schon nicht über die Grenze schieben. Meinte ich jedenfalls. Nach langem Palaver sollte ich am nächsten Morgen um acht Uhr am Auto stehen, zwei Personen würden mich anschieben und dann sollte ich in eine genannte Werkstatt fahren, ich wäre angemeldet. Wie es sich am anderen Tag herausstellte, wurde ich weder angeschoben, noch war ich in der Werkstatt angemeldet. Als ich früh zur vereinbarten Zeit am Auto stand, war weit und breit niemand zu sehen. Natürlich wartete ich ein Weilchen über die Zeit, war dann jedoch war ich von der Ignoranz und der schlaff schlampigen Art so vergnatzt, dass ich versuchte, das Auto selbst anzuschieben und aufzuspringen, was mit viel Fluchen und wegen dem abschüssigen Gelände endlich gelang. Die Werkstatt war weiter entfernt, als ich dachte; der Empfang war unfreundlicher als ich dachte. Hier wird nur ein Typ von Fahrzeugen repariert und das sind dazu russische, blöffte man mich unfreundlich an. Für mich gäbe es ausserdem keine Ersatzteile. Dieses Auto wird hier nicht repariert. Ich solle wieder gehen. Es ist erstaunlich, wie der Mensch organisiert ist. Russisch habe ich in der DDR immer mit Widerwillen gelernt, aber zumindest so viel, dass eine mittlere Zensur nicht meinen guten Durchschnitt herabzog. Was mit Unwillen gelernt wird, vergisst man wieder schnell, zumal wir in der Schule so genanntes Zwecklernen beherrschten. Das heisst, mündliche Aufgaben wurden Zuhause nicht erledigt, sondern in den Pausen kurz vor der Stunde gebetsmühlenartig eingelernt. So war man in der Stunde fit, allerdings verflüchtigte sich das Gelernte wieder schnell. Ich hätte nie gedacht, dass ich vor Wut noch so viel Russisch zusammenbringen könnte, um mich energisch zu wehren. Hier sei kein Ersatzteil kaputt, donnerte ich, hier müsse erst einmal nachgesehen werden. Ich sei übrigens Tourist und zu pflegen und müsse heute noch das Land wieder verlassen, sonst sei die Polizei da. Aber dann gäbe ich der Werkstatt die Schuld. Das Palaver ging hin und her. Es wurde telefoniert. Schliesslich erschien, gemächlich und unlustig antrabend, ein Automechaniker ( ich nehme an, es war der Chef ) und hörte sich uninteressiert tuend und genüsslich lächelnd das Theater an. Ich hatte ein langes, umfangreiches Papier auszufüllen, dann wurde vorsorglich nach Rubel gefragt. Aber da hatte ich mir schon angstvoll alles Verfügbare eingesteckt. Die Familie im Hotel hatte keine Kopeke. Nach einer, wie mir schien, unendlichen Zeit durfte ich in eine alte, ziemlich hinfällige, grosse Halle einfahren. Hier standen jede Menge Fahrzeuge gleichen Typs. Mechaniker arbeiteten in aller Seelenruhe daran. Ich bekam einen freien Platz zugewiesen und parkte erleichtert ein. Kaum stand ich und stieg aus, wurde ich samt Fahrzeug umringt. Jeder betrachtete den Wartburg wie ein nie gesehenes Vehikel und reckte den Hals. Ich radebrechte, was den Fehler betraf und öffnete die Motorhaube. Alle schauten in den Motorraum. Zwischen lachen und wundern zeigten sie auf den Motor und sagten geringschätzig : “ malenki “, klein. Wir kamen in lustigen Streit, denn ich zeigte auf den Kilometerzähler und nannte den Verbrauch und das Tempo. Sie wiesen auf die gewaltigen Motoren in ihren Fahrzeugen hin. Schliesslich vertrieb der Mechaniker die Runde und wir waren allein vor dem Auto. Nach einigen schnellen Handgriffen und Proben erläuterte er mir, dass der Anlasser defekt sei, man nicht an ihn herankäme und der Kotflügel abgeschweisst werden müsse, um ihn auszubauen. Ausserdem wären keine Ersatzteile da. Da sei nichts zu machen. Der Monteur war unrasiert und ziemlich fett im Gesicht und zeigte die ganze Zeit ein ruhiges, überlegenes, geringschätziges Lächeln. Seine Statur war gedrungen und sehr kräftig. In seiner Arbeitskombination sah er ausgesprochen ungepflegt aus. Das war nicht, was mich störte. Aber er hatte offensichtlich keine Lust und schien eine gewisse Freude daran zu haben, das es nicht so gehe, wie ich das wollte. Ich drängte ihn mit Mühe zur Seite. Der Frontgrill beim Wartburg lässt sich mit einigen wenigen Handgriffen abbauen. Genau das hatte ich vor und wühlte im hinteren Auto eine Blechkiste hervor. Darin befanden sich sauber eingelegt Steck- und Maulschlüssel, eine Ratsche und andere Gerätschaften, mit denen ich die Schrauben am Grill lösen konnte. Es war eine Blechkiste mit glänzenden Werkzeugen, ein chinesisches Produkt und in der DDR nicht zu jedem Zeitpunkt zu erhalten. Deswegen wurde es von mir gehegt und gepflegt und vor allem zusammengehalten. Ich hätte mir denken müssen, dass dieses Werkzeug erneut Aufmerksamkeit erregte. Schliesslich kam ich mir ein bisschen wie ein Privilegierter vor: Mit einem besseren Auto und besserem Werkzeug. So, dachte ich mir, muss sich ein Wessi im Osten fühlen. Jedenfalls war die Geringschätzigkeit weg und man staunte. Der Grill war schnell gelöst und der Anlasser schnell ausgebaut und geöffnet. Jetzt zeigte mir der Monteur fast ein wenig mit Bedauern, das die Kontakte zum Rotor, die Kohlebürsten, völlig abgenutzt waren und keinen Kontakt mehr gaben. Und Ersatz sei weit und breit leider nicht zu erhalten. Man mag es glauben oder nicht: Ich ging in eine andere kleine Ersatzteilkiste und zog verschiedene Kohlebürsten hervor, denn ich hatte nicht nur Ersatz für den Anlasser, sondern auch für die Lichtmaschine. Es waren die rechten Kontakte dabei und ich war guten Mutes in kürzester Zeit die Werkstatt verlassen zu können. Statt dessen ereignete sich etwas anderes. Urplötzlich räumten alle Mechaniker ihre Werkzeuge zusammen, verstauten sie jeweils im zu reparierenden Auto und schlossen ringsherum die Türen zu und steckten die Autoschlüssel ein. Dann schlenderten sie aus der Halle. Es erschien auch gleich der vermeintliche Chef und trieb uns an, ein gleiches zu tun. Natürlich protestierte ich. Wenige Handgriffe seien zu machen. Ich sei Tourist und benötige doch etwas Hilfe, und so weiter. Mein Lamentieren half rein gar nicht. Mein zuständiger Mechaniker zuckte die Schultern und räumte wie selbstverständlich auch alles zusammen und schloss alles zu. Dann schob er mich aus der Halle. Diese wurde zugeschoben. Um die kräftigen Griffe schlang man eine noch kräftigere Kette und mit einem grossen Vorhängeschloss war ich ratzfatz von meinem Wartburg getrennt. Unterdessen war Mittag geworden. Ich merkte es am knurrenden Bauch und hatte nichts dabei, um den Hunger zu stillen. Sicherlich hätte ich eine kleine Notverpflegung am Auto gefunden, aber da kam ich auch nicht mehr heran. Die Sache war schon vertrackt. Also trottete ich dem Mechaniker lustlos hinterher. In seiner Richtung würde es schon etwas geben und ein paar Rubel hatte ich ja noch. An der Ausgabetheke versuchte ich dann richtig, etwas Essen zu erhalten. Aber da kam ich beim Personal falsch an. Da ich keine Essenmarken hätte, könne ich auch nichts erhalten. Nein, kaufen könne ich für heute keine Marken mehr, das hätte ich gestern erledigen sollen. Und gegen Bargeld gäbe es gleich gar nichts. Ich wurde langsam wütend. Aber da sprang mein Mechaniker ein. Nach einem heftigen Disput mit dem Personal wurden mir ein Teller, ein grosse Tasse und ein kräftiges Stück helles Brot ausgehändigt und mein Portmonee beiseite geschoben. Jetzt galt es einen Tisch zu suchen. Das war schwer. Überall waren entweder die Tische besetzt oder der Tisch voll Geschirr. Ich fand endlich einen unbesetzten und schob die ineinander gestapelten Teller und Tassen zur Seite und plazierte mein Essen. Klar hat jedes Land seine Kultur, die man als Gast besonders zu respektieren hat. Aber mir war es nicht zu vermitteln, warum ich in einen Teller, der noch Essenreste beherbergte, einen anderen hineinsetzen musste und in diesen, ebenfalls nicht leer, eine Tasse patschte. Als ich zunächst noch ein Papiertaschentuch zückte – ich hatte in der DDR immer welche in der Tasche, weil meine Frau eine Drogerie hatte, ansonsten waren sie in der Regel sehr knapp – und den Tisch damit abwischte, darauf auch noch den Sitz vom Stuhl, bemerkte ich einige unwillige Aufmerksamkeit und missbilligende Blicke. Hier wollte jemand etwas besonderes sein und das wurde nicht für gut geheissen. Viel Zeit hatte ich nicht, das genauer zu bemerken, als ich mich auf den Teller konzentrierte. In ihm schwamm eine glasklare Brühe, so ungefähr vier winzige Stückchen Mohrrübe und einige Kräuter nebst einigen, aber wirklich nicht vielen Fettaugen und zwei Erbsen. Ich kostete die Brühe. Sie schmeckte fad und ungewohnt. Abwaschwasser hätte ich Zuhause dazu gesagt. Jetzt hatte ich Mühe, den vollen Teller Suppe nicht auch in andere zu stellen, damit ich Platz auf dem Tisch bekam, aber es ging. Nun schaute ich in die grosse Tasse und kostete vorsichtig. Ein sahniges Etwas, wenn nicht gar blanke Sahne vom Feinsten. Das liess ich mir zusammen mit dem gut schmeckenden Bauernbrot munden und war bald darauf angenehm satt. Das hatte alles geraume Zeit gedauert. Die meisten hatten Zigaretten geraucht und geredet, sie erhoben sich und strebten nach draussen. Ich schloss mich an. Nicht ohne mich für das kostenfreie Essen zu bedanken. Die Halle wurde rasselnd geöffnet, die Autos aufgeschlossen und alle Werkzeuge und Ersatzteile hervorgeholt. Es wurde wieder gearbeitet. Der Monteur widmete sich nun intensiv meinem Anlasser. Er baute ihn auseinander, spannte den Rotor in eine Drehbank und schliff den Anker trotz meines Protestes mit viel zu grobem Sandpapier blank. Feinstes Schleifpapier, extra dafür geeignet, hätte ich in meiner Ersatzteilkiste übrigens auch dafür gefunden. Es war mir wie eine Ewigkeit, als endlich alles am Auto wieder an seinem Platz war. Die anderen schauten zu, als der Motor ohne Mühe ansprang und sich freudig drehte. Es gab noch ein wenig Palaver untereinander und mir war, als stritte man hier und da über mein Gefährt, denn man verglich die Motoren noch einmal und diskutierte über den Tacho. Besonders ein Monteur, so ein schlanker und schmaler, der ein bisschen scheu und verhalten wirkte, schien sich der Meinung der anderen nicht ganz anzupassen; sie debattierten hin und her, aber ich konnte nicht mitbekommen, worum es ging. Als ich meinen Monteur danach befragte, lachte der nur, winkte geringschätzig ab und sagte: „Jude“. Ich war tief erschrocken. Nicht die DDR, aber alles was sonst deutsch war, war mit dem Stigma der Judenvernichtung behaftet und keiner durfte sich je erlauben, dieser Völkergruppe Geringschätzigkeit entgegenzubringen. Noch abstruser fand ich, dass dies jetzt just in der Sowjetunion stattfand, die uns stets als Vorbild an Moral und Bewusstsein vorgehalten wurde. Ich wollte, schon aus eingetrichterter Pflicht, dagegen protestieren, aber man wiederholte das Wort wie ein Schimpfwort und zerstreute sich lachend. Der Papierkram an der Kasse war aufwendig. Froh war ich, dass die Rubel zum Bezahlen reichten und sogar noch etwas übrig blieb. Schnell machte ich mich aus dem Staub und strebte dem Hotel und meiner Familie zu. Die hatte unterdessen zu leiden gehabt, denn da ich keine Kopeke im Hotel gelassen hatte, konnte sie auch nichts essen. Jetzt, am sehr späten Nachmittag, holten wir das schleunigst nach. Nie hätte ich gedacht, für diese wenigen Handgriffen fast einen ganzen Urlaubstag zu benötigen. Trotz aller Versuche, den Urlaub zu verlängern, wurde uns bedeutet, dass wir noch heute das Land zu verlassen haben. Ganz nach Vorschrift eben. Aber ohne Herz und Seele. Wir beeilten uns mit dem Packen, wollten aber noch von dem sehr billigen Benzin profitieren. Tanken war immer ein bisschen ein Problem, weil, wie wir sagten, es nur „blankes“ Benzin gab, aber der „Wartburg“ ein 1:33 Gemisch benötigte. Also musste man stets einen Vorrat an Motorenöl mitschleppen und ihn vor dem Tanken einfüllen, damit ein einigermassen gutes Gemisch beim Einwirbeln des Benzins entstand. Wir fanden eine Tankstelle. Ich schätzte den ungefähren Bedarf und füllte das Öl ein. Dann musste man die Rubel für den geschätzten Benzinbedarf im Voraus bezahlen. Als der Tank offen war und die Zapfpistole im Einlauf steckte, wurde die Menge vom Tankhäuschen aus frei gegeben und das Benzin konnte ungehindert laufen. Ungehindert war der rechte Ausdruck. Denn ich hatte so geschätzt, dass ich möglichst viel des billigen Treibstoffes ins Auto bekommen würde. Nun, es war etwas zu viel und lief über, obwohl ich vorsorglich den Wagen mit kräftigen Rucken an der Seite und hinten geschüttelt hatte, damit der Tank ja an allen Stellen voll sei und keine Luftblasen die Aufnahme behinderten. Das klappte ja auch in der Regel. Kaum hatten die ersten überlaufenden Tropfen den bereits schon vorher getränkten Erdboden erreicht, als mir jemand leicht auf die Schulter klopfte, den Tankschlauch entschuldigend lächelnd meinen Händen entwand und in seinen mitgebrachten Kanister steckte. Ich hatte den Mann mit dem Kanister zwar schon vorher bemerkt, hatte aber mit mir und dem ganzen Vorgang genug zu tun, so dass ich ihn nicht weiter beachtet hatte. Es war ein LKW-Fahrer, der uns schon eine Weile beobachtet hatte und nun die Gelegenheit nutzte, etwas Benzin gutzumachen. Er war mit einem Fahrzeug voll Kies unterwegs und wir kamen mit Händen und Füssen gestikulierend ins Gespräch. Klar war er Lkw-Fahrer in einem grösseren Betrieb, aber den Kies transportierte er so nebenbei privat für einen Verdienst in die eigene Tasche, erläuterte er. Das Leben sei so teuer und er müsse nebenbei verdienen, sonst reiche es nicht. Mit guten Wünschen beiderseits trennten wir uns bald, denn ich hatte es eilig, die Grenze zu erreichen und auch noch einen Unterschlupf für die Übernachtung zu suchen. Wir wussten ja nicht, was uns auf der rumänischen Seite erwartete und Touristen trafen wir die ganze Zeit nicht einen einzigen. Da hätte man sich an Erlebnissen und Erfahrungen austauschen können. Wir kamen ungehindert an die Grenze, der Schlagbaum war unten und kein Auto oder Mensch weit und breit zu sehen. Ich brachte das Auto geräuschvoll zum Stehen, schob das Schiebedach so, dass uns die brennende Sonne nicht auf die Köpfe schien. Dann warteten wir frohgemut, denn Wartezeit würde sich hier aufgrund der fehlenden Schlange nicht ergeben. Es war ein Irrtum. Nach einer Viertelstunde liess sich immer noch kein Zoll- oder Grenzbeamter blicken. Dafür brannte die Sonne unbarmherzig und die Luft flirrte trotz des späteren Nachmittags immer noch vor den Augen. Da ich vereinzelt Gesprächsfetzen und Lachen aus dem angrenzenden Gebäude wahrnehmen konnte, öffnete ich die Wagentür, stieg aus und ging dem Lärm mutig entgegen ins Haus. Es war eine lustige Runde mit Alkohol und sicher kräftigen Spässen, jedenfalls den Lachsalven nach zu urteilen. Man nahm mich uninteressiert zur Kenntnis. Einer runzelte leicht die Stirn und hob leicht schräg den Kopf, so dass ich annahm, er wolle wissen, was es denn hier gäbe. Ich radebrechte, dass ich schon spät dran sei und gern schnell über die Grenze möchte. Er nickte mit dem Kopf, hob beschwichtigend die Hand, sagte „Moment“ und wies mich hinaus. Ich ging. Nach fast eineinhalb Stunden kam der Grenzbeamte zum Auto. Wir sassen schwitzend und unmutig darin, denn zur damaligen Zeit konnte man sich nicht trauen, ungehindert am Grenzübergang spazieren zu gehen. Er schaute kurz ins Fahrzeug, beugte sich leicht vor und sagte spöttisch: „Nu, das ist Moment!“. Dann hob er den Schlagbaum und ohne uns weiter zu kontrollieren, winkte er uns durch die Grenze. Ich habe da so eine Handbewegung. Meine Frau meint, sie drücke absolute Geringschätzigkeit aus und sei nicht sehr fein. Die machte ich, startete das Auto und gab vorsichtig Gas, aber es gab keine weiteren Kontrollen und so rollten wir durch die Grenze unendlich erleichtert ins Rumänische. Der Ansicht des Grenzers, was ein Moment ist, hatte ich in dem Augenblick nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Es war seine Ansicht, ausschliesslich seine Ansicht, meine nicht. zum Anfang der Geschichte
|
||||||||