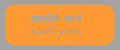 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Geschichten 12 und mehr... |
||||||
|
12. Der Mister muss weg oder eine Wohnung muss her Im Jahr 1987 begann ich die Geduld zu verlieren. Ja sicher, es gab genügend Anlässe in den vorangegangenen Jahren, dies bereits schon vorher zu tun. Aber stets hatten wir einen Ausweg gefunden, immer wieder alles zu unserer Zufriedenheit zu lösen. Und nicht zuletzt waren wir daran gewöhnt, mit Kompromissen zu leben. Wir kamen damit gut zurecht. In dem Fall indessen wuchs uns der Zustand langsam über den Kopf. Wir wohnten in einem Einfamilienhaus mit dem Baujahr 1934. Das heisst, es hatte gewisse Qualitätsnormen, aber auch gewisse Schwächen. Die Schwächen waren eindeutig die kleinen Zimmer, denn der Architekt hatte das Haus nicht in der Grösse acht mal acht Meter konzipiert, sondern auf jeder Seite zwanzig Zentimeter eingespart. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, da ich frisch ins Haus zog. Mein Schwiegervater lebte damals noch und hatte diese fehlenden Zentimeter immer beklagt. Ich hatte mich stets gewundert. Man muss ja mit dem auskommen, was man hat. Und ein Haus war zur damaligen Zeit schon etwas. Aber später konnte ich die Klage nachvollziehen. Wir lebten später zusammen mit unserer Schwiegermutter im Haus. Omi hatte eine Stube in der oberen Etage und eine kleine Küche. Bad und Toilette wurden gemeinsam genutzt. Das Bad war die ausgebaute Waschküche im Keller. Es war voll ausgefliest. Dazu muss man erzählen, dass es in der DDR Fliesen nur in limitierten Stückzahlen gab, die man lange vorher bestellen musste. Die Wartezeiten waren unterschiedlich und recht oft ganz erheblich. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man nur fünf Quadratmeter bestellen und erhalten. Die Bäder aber wollte man zur damaligen Zeit möglichst ringsherum und bis zur Decke ausgekleidet sehen. Da gab es mehrere Wege, die entsprechende Menge zu ergattern. Der einfachste Weg war, diese über den Intershop zu beziehen. In diesen Geschäften gab es Waren aus dem westlichen Ausland, die es anderswo nicht gab, allerdings gegen die entsprechende Währung: Westgeld hiess es bei uns. Allerdings benötigte man dazu Verwandte, die im Westen Deutschlands wohnten und die Fliesen bezahlten oder die Währung lieferten. Dieser Weg war uns versperrt. Ein weiterer Weg war, sich Devisen oder Westmark zu besorgen. Da musste man aber Leute kennen, die im Lande über Westmark verfügten und sie in einem Umtauschsatz zwischen eins zu fünf bis eins zu zehn in Ostmark einzuhandeln. Erwischen lassen durfte man sich dabei nicht und unangemessen teuer war es in der Regel auch. Natürlich konnte man auf bestimmten Wegen auch einen Schwarzkauf mit Inlandgeld arrangieren, denn es gab immer Leute, die die Fliesen verschoben. Aber dann musste man in der Regel mit dem Muster vorlieb nehmen, das gerade vorhanden war. Wir fanden einen überraschenden Weg. Wir fuhren, als der modernisierende Ausbau des Bades in Angriff genommen werden sollte, auf die Scharfenberger Straße in Dresden. Dort konnte man zu gewissen Zeiten Fliesen bestellen und diverses Baumaterial bekommen. Oder auch nicht. Wir fuhren also hin und kamen ausserhalb der vorgeschriebenen Bestellzeiten im Verkaufs-Büro an. Deshalb war nicht allzu viel Betrieb. Ich kam auch gleich an die Reihe. Auf die Frage, was ich möchte, antwortete ich – für meine Begriffe sehr unverfroren: Etwa fünfzehn Quadratmeter Fliesen. Die Verkäuferin reagierte ungerührt mit der Frage, welches Muster es denn sein sollte. Wir mussten uns eine ganze kleine Weile erst fassen, um zu begreifen, dass die Frage kein Scherz, sondern voller Ernst war. Überraschend war eine sehr grosse Lieferung bulgarischer Fliesen eingegangen. Sie hatten zwar unüblich voluminöse Abmessungen, aber das war uns egal. Aus den zwei vorliegenden Muster wählten wir uns eines mit einem Dekor, dass die Fliesen teilte und recht angenehm, wenn auch ein wenig fremd wirkte. Zugleich kauften wir einen Quadratmeter mehr, weil Abmessungen und Farben von der Norm abwichen. Denn selbstverständlich waren es Fliesen der dritten und noch schlechteren Wahl. Aber wir waren froh, so unkompliziert unser Problem gelöst zu sehen und fühlten uns als echte Glückspilze. Soweit zum Bad. Die Zimmer im Haus waren also nicht allzu groß, denn wenn man sie neu einrichten wollte, fehlten, wie gesagt, immer die berühmten Zentimeter, damit man eine normgerechte Schrankwand aufstellen oder eine entstandene Lücke geschickt ausfüllen konnte. Wir bauten im hohen Treppenhaus eine Zwischenwand ein und nutzten die gewonnene Fläche als zusätzlichen Schrank. Schliesslich baute ich den Boden aus und so gewannen wir ein Schlafzimmer. Es war zwar nicht groß, weil alle vier Seiten des Daches zur Rinne abfielen. Aber wir waren glücklich und hatten alles in Holz so gut ausgebaut, dass wir nicht einmal in strengen Wintern die Heizung in Betrieb nehmen mussten. Normal und selbstverständlich war der Ausbau mit dem Holz nicht, denn wir hatten feinste Bretter zur Verfügung mit wenig Ästen und aus vornehmer Lärche. Das hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht in Hinterhand einen guten Freund als Tischler und mit gutem Willen gehabt hätten. Die Probleme kamen mit den Kindern. Unbedingt wollten wir zwei; erst eine Tochter, dann einen Sohn. Und genau in dieser Reihenfolge. Das war noch kein Problem. Ein naher Freund, ein guter Gynäkologe, beriet uns über die zugegebenen geringen Möglichkeiten, das Geschlecht im Vorhinein zu bestimmen. Immerhin wusste er, so glaube ich mich zu erinnern, sieben Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit des Wunsches näher rücken sollten. Mir sind heute nur noch drei in Erinnerung geblieben. Aber die Reihenfolge des Kinderkriegens war perfekt, genau nach Wunsch, erst wurde Sofie geboren, neun Jahre später Oliver. Genau geplant, mit inniger Freude und gewollt. Durch den Bodenausbau hatten wir zwar ein Kinderschlafzimmer gewonnen. Das war gut, solange unser Nachwuchs klein war. Es machte uns aber mit zunehmendem Alter der Kinder Sorgen. Schliesslich wurde Sofie langsam achtzehn und wir hatten keinen Ausweg, ein getrenntes Kinderzimmer einzurichten. Damals Wohnungen zu erhalten, war schlichtweg ein schier aussichtsloses Spiel. Ich habe einen Arbeitskollegen, Dieter Echterrmeyer, in Erinnerung, der eines Tages mit Bildern auf Arbeit erschien, bei denen ersichtlich das Wasser in Strömen vom Boden durch die Zimmerdecke in die Wohnung gelaufen war und dabei in der Schrankwand Bücher, Ausweise und Unterlagen aufgeweicht und jede Menge Schaden angerichtet hatte. Die aufgestellten Eimer auf dem Boden hatten dem schadhaften Dach nach einem heftigen Regen nicht standhalten können und waren übergelaufen. Er hatte die Bilder mit einer kräftigen Beschwerde an den Staatsrat der DDR gesendet und hoffte damit auf Hilfe. Ein junger Kollege, Peter Stanislaus, wiederum bemühte sich, aus einer feuchten Wohnung ausziehen und eine neue beziehen zu können, weil seine Tochter Asthma hatte und die schimmeligen Wände die Gefahr einer zunehmenden Allergie heraufbeschworen. Auch das zog sich in unendliche Längen. Es war einfach nichts da. Der gängigste Ausweg war, sich in einer AWG, einer Arbeiterwohnungsgenossenschaft, anzumelden und eine lange Wartezeit in Kauf zu nehmen. Je nach aktueller Familiengröße bekam man eine Wohnungsgröße für eine erträumte Neubauwohnung zugemessen. Das war schon etwas, nicht mehr den Kohleofen einzuheizen und sich nicht mehr um die Beschaffung der Heizmaterialien kümmern zu müssen. Für unser Haus war das Kümmern um Heizmaterial schon ein Problem gewesen. Wir hatten uns zunächst mit Mühe und Beziehungen eine Schwerkraft-Wasserheizung einbauen lassen. Die Heizkörper hatten wir mit viel Glück erschlichen. Das Wort klingt besser als geschoben, ist aber dasselbe. Sie waren aus Gusseisen und hatten das Flair der Vorkriegszeit. Den üblichen dünnen Blechkonvektoren eilte der Ruf voraus, ineffektiver, unansehnlicher zu sein und schneller undicht zu werden. Also, wir hatten eine Zentralheizung im Haus, aber zunächst nicht das entsprechende Heizmaterial dazu. Braunkohlenbriketts konnte man sich in beliebiger Menge anliefern lassen. Wir beschimpften sie mit dem Ausdruck „Blumenerde“, denn sie brannten schnell durch und lieferten eine grosse Menge Asche. Da wir unsere Schwiegermutter im Haus hatten und sie die Heizung keinesfalls bedienen konnte, mussten wir uns überlegen, wie wir die Wärme während unserer Abwesenheit auf Arbeit im Haus auch bei grösserer Kälte aufrechterhalten konnten. Gut, man bekam zwanzig Zentner Gaskoks für das Heizungsjahr geliefert. Dieser heizte recht gut und hielt das Haus für die Abwesenheit angenehm warm. Aber die Menge reichte für einen Winter weder hin noch her. Wir fanden einen Weg. Ihn bahnte meine Frau in ihrer Drogerie. Jedermann war gut dran, wenn er etwas zur Verfügung hatte, was in der Regel mit Knappheit belegt war. In der Drogerie waren es immer wieder mal wechselnd zum Beispiel Papiertaschentücher oder Zellstoff für Kranke, einmal gab es längere Zeit keine schwarze Schuhcreme, ein bestimmtes Seifenpulver war in der Regel knapp. Mal gab es keine Zahnbürsten oder Kerzen. Und Silvester-Knaller waren immer beschränkt zu erhalten Das war die Chance. Denn die Leute, die uns aus dem Kohlehandel belieferten, waren immer dieselben und sie hatten bald erfahren, dass meine Frau eine Drogerie besass. Sie benötigten schlicht und einfach für jedes Jahr – wie in einem Abonnement – einige grosse Kartons mit insgesamt dreihundert Blitz- und Pfauknallern. Das waren kurze Stäbchen mit einer Anreibefläche wie sie Streichhölzer hatten. Gezündet knallten sie ganz erheblich und gaben Blitze oder buntes Feuer von sich. Mit einer jährlichen zuverlässigen und zusätzlichen Lieferung von Koks liess sich ohne Mühe die bisherige Menge Koks verdoppeln und reichte damit gut über die kalte Jahreszeit. Um aber nicht glauben zu lassen, dass damit eine bequeme Heizung möglich war, muss ich noch eine Information nachreichen. Anfangs war der Koks gesiebt und das Heizen eine Erleichterung. Aber auch der Koks erfuhr im Laufe der Jahre eine Verknappung und so wurden die Siebe, mit denen man den Koks vom Grus befreite, zugeschweisst und man erhielt jede Menge feinen Koksstaub mitgeliefert. Jetzt war ich in einem Dilemma. Den Koks hätte ich mir aufschütten lassen und ihn dann gesiebt und ziemlich sauber in den Keller schaufeln können. Aber da machten mir die Kohleleute einen Strich durch die Rechnung. Der Koks musste in dieser Menge umgehend im Keller verschwinden, denn andere Bürger, insofern sie auch gern ausreichend Koks bekommen hätten, passten unter Umständen auf und eine Meldung hätte die Schieberei unangenehm auffliegen lassen. Also schnell und unauffällig alles rein in den Keller. Nebst mit jedem Jahr steigender Menge stiebenden Grus. Diesen auszusieben war im engen Kohlenkeller schier unmöglich. Also versuchte ich die Trennung beim Heizen zu erreichen. Das geschah am Ende so, dass ich mich splitternackt im geschlossenen Kohlenkeller vor dem Kessel präsentierte und ihn bis zum Rand mit Koksstücken voll stopfte. Den Staub und Grus entsorgte ich später. Nach dem Heizen duschte ich den fettigen Staub vom Körper und hatte mit vielem Gurgeln und ausspucken kräftig zu tun, den Hals vom schwarzen Auswurf frei zu bekommen. Unangenehmer Nebeneffekt war, dass ich zur ganzen Heizungsperiode einen wunden Hals hatte, der die Ärztin zum Kopfschütteln und Schulterzucken veranlasste, mir aber eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit bescherte. Sicherlich waren da auch die vielen Schornsteine schuld, die den Rauch der Briketts in Unzahl zum Himmel, aber vorher auch vom Wind durch die Straßen und zum Einatmen brachten. So weit zu Freud und Leid zum Heizen zur Winterszeit. Zurück zur Wohnungsnot und dazu, dass damals Wohnungen zu erhalten, schlichtweg ein schier aussichtsloses Spiel war. In meinem Umfeld suchten also eine Menge Leute eine neue Wohnung. Die wahrscheinlichste Lösung war, sich in einer Arbeiter- und Wohnungsbaugenossenschaft, kurz AWG genannt, anzumelden. Die Anmeldung war kompliziert, weil man sich zwar anmelden konnte, aber die Verfügbarkeit der Wohnungen nicht mit dem Verfall der alten und also mit dem Bedarf der Menschen konform ging. War man endlich in der Warteschlange vorangerückt, wurde man je nach Familiengröße in die entsprechenden Typen der Wohnungen eingeordnet. Dann waren dafür so genannte Aufbaustunden zu leisten. Für eine Dreiraumwohnung waren siebenhundertfünfundzwanzig Stunden zu leisten. Eine Einraumwohnung hatte, alles einberechnet, also auch Toilette und so weiter, insgesamt sechsundzwanzig Quadratmeter, die Wohnstube davon allein fünfzehn Quadratmeter. Die Arbeit in den Aufbaustunden umfasste Aufräumungsarbeiten, Enttrümmerung des Geländes, ebnen des Erdbodens, Begrünen von Außenanlagen. Die Stunden waren selbstverständlich zusätzlich zur Arbeitszeit zu leisten, wobei die sonntäglichen Einsätze doppelt angerechnet wurden. Bernd, ein damaliger Arbeitskollege von mir hatte Glück, indem er nach umfänglichen ebnen, Säen von Gras und einebnen überraschend das Angebot erhielt, die noch offenen Stunden von ungefähr sechzig bis siebzig Stunden zu bezahlen, weil die Wohnung vorzeitig fertig gestellt wurde. Er nahm dies gern an und beglich die Stunden mit je damaligen fünf Ostmark. Mir war die Verfahrensweise zu suspekt. Eine genormte Wohnung zu erhalten, die ein Massenprodukt war und bei deren Enge und Aufbau man schon vorher wusste, wo die obligatorische Schrankwand und wo das Sofa oder die Liege zu stehen hatte, war nicht meine Vorstellung. So sahen viele Wohnungen eines Typs genau analog eingerichtet aus. Wie ein ideologischer Rückschluss auf die augenblickliche Staatspolitik. Ausserdem schwebte mir vor, sich nicht in dem und allgemein üblichen modernen Trend einzurichten, sondern ich wollte zumindest teilweise alte Einrichtungsgegenstände und Gerätschaften um mich haben und ich erinnere mich an meine Mutter, wie sie zu einem späteren Zeitpunkt über unsere Wohnungseinrichtung kopfschüttelnd ihr Unverständnis zeigte: Das sieht aus wie ein Museum, aber nicht wie eine Wohnung. Freilich, zu einem modernen Staat, jung, emporstrebend, dem Sozialismus entgegeneilend musste eine alte Einrichtung antiquiert entgegenstehen. Wer also der Uniformierung ausweichen wollte, musste sich mit Altbauwohnungen zufrieden geben. Hier war das Dilemma, entsprechendes Baumaterial zu bekommen und genau so schlimm, die entsprechenden Handwerker dazu. Letztere waren chronisch bis dramatisch knapp und so wurde vieles nebenberuflich und ausserhalb des offiziellen verrichtet. Nachteil eines Altbaus war die unausweichliche Ausrüstung mit einem Kachelofen und die Plackerei mit den Briketts. Eine Aussenwandgasheizung zu erringen, galt als Glücksfall. Ich überließ alles der Entwicklung und glaubte, irgendwo schon eine Lösung zu finden. Richtig kam ich auch im Einfamilienhaus meiner Schwiegereltern unter und wir beide, meine Frau und ich, waren mit den beengten Möglichkeiten dennoch recht zufrieden. Jetzt jedoch wurden die Kinder größer. Die Räume reichten nicht und wie ganz am Anfang der Geschichte betont, begann ich mit diesem Staat die Geduld zu verlieren. Es galt also etwas zu unternehmen, um zu einer Lösung zu kommen. Ich ging deshalb aufs Amt. Das Amt war die Stadtbezirksverwaltung auf dem Fritz-Förster-Platz in Dresden. Dort meldete ich mich in der Wohnungsverwaltung an und trug einen langen Sermon vor. Dass ich also bei Robotron in der Forschung lange genug für den Sozialismus geschaffen habe. Dass meine Frau sich langjährig in einer selbständigen Drogerie um eine gute Bevölkerungsversorgung bemüht hätte. Und ob ich denn bei unserer offensichtlichen Notlage baldigst mit einer Wohnung für meine Tochter rechnen könne. Das konnte ich natürlich nicht. Und nicht nur das, man zeigte ein offensichtliches Erstaunen über mein Begehren, denn schliesslich wüsste ich ja selbst, wie schwer Wohnungen zu bekommen seien und schliesslich müsste ich das verstehen. Aber ich wollte nicht verstehen und legte meine Argumente dar. Wenn, so meine Begründung, wir mit einem Außenlager für die Drogerie meiner Frau schon das zweite Mal umziehen müssten, nur weil das Haus zusehends verfällt und nur deshalb verfällt, weil das Dach undicht und so von Jahr zu Jahr eine Etage nach der anderen unbewohnbar wird und ein sonst attraktives Haus verlottert – und dafür habe ich sowohl in Dresden-Plauen, also im zuständigen Bezirk, auf der Fritz-Schulze-Straße Beispiele parat, als auch genügend in der Dresdener Neustadt, wo ein ganzer Stadtteil verfällt – dann habe ich nur eine Schlussfolgerung: Der zuständige Minister ist unfähig, denn gerade auf der Fritz-Schulze-Straße wären wenige Rollen Dachpappe schon eine Rettung gewesen. Also, entweder ich bekomme eine Wohnung oder ich fordere öffentlich, dass der zuständige Minister abtreten solle. Diesmal lachte man über mein Begehren. Aber ich machte ganz schnell deutlich, dass ich es ganz todernst meine und es rein gar nichts zu lachen gäbe. Mit allen Möglichkeiten, die ich finden werde, erklärte ich, werde ich überall und bis nach Berlin auftreten. Jetzt wurde mir bedeutet, dass ich ein wenig warten solle und kurz darauf erhielt ich einen nahe liegenden Termin, den ich doch wahrnehmen solle, denn da wäre jemand aus der Bezirksverwaltung anwesend und zuständiger als hier auf der Stadtbezirksverwaltung. Den neuen Termin nahm ich mit meiner Tochter wahr. Es konnte aus meiner Sicht nicht schaden, wenn sie mal eine rigorose Reaktion gegen die Staatsbediensteten mitbekommen würde. So etwas, dachte ich, prägt vielleicht auch für die Zukunft und hilft dann in den verschiedensten Lebenslagen, sich durchzusetzen und sich nichts gefallen zu lassen. Uns saßen vier Personen gegenüber und ich trug in wilder Entschlossenheit unser gemeinsames Begehren vor, nicht ohne zu betonen, dass meine Loyalität dem Staat gegenüber auch mal eine Leistung des Staates verlangt, um so mehr, als dass er just auf diesem Gebiet offensichtlich zum Nachteil der Bevölkerung schlampert. Das sei ein Arbeiter- und Bauern-Staat sagte ich, und wenn er erkennbar auf der einen Sparte nicht richtig regierte, sei da was faul und genau dort verlange ich eine Änderung – oder schleunigst eine Wohnung für meine Tochter. Und setzte ich hinzu, keine Ausbauwohnung und ziemlich in der Nähe von unserem Haus. Das eigenartige an diesem Gespräch war, dass mir von einem Teil der Gegenübersitzenden so etwas wie eine offene Feindschaft herüberwehte. Es war wie ein abgestandener Beamtenmief mit sozialistischer Prägung: „Wie können Sie etwas wollen, das wir für sie nicht vorgesehen haben, wir denken doch für sie, das steht ihnen nicht zu.“ Vom den anderen Teil aber kam eine hilflose Zustimmung, so als freuten sie sich, dass da ein Widerspruch kam, der zwar keinesfalls erlaubt war und mit einer verkrampften Verlegenheit gepaart erlebt wurde. Die Vier diskutierten mit mir eine Weile, einigten sich aber plötzlich sehr schnell: Ich würde in Kürze Bescheid erhalten. Nein, wehrte ich ab, vage Zusagen kenne ich da zur Genüge. Ich verlange schon feste Termine, ansonsten würde ich mich flugs in Bewegung setzen. Aber, entgegnete man mir, innerhalb von vierzehn Tagen würde ich einen Bescheid erhalten. Meine Tochter Sofie hatte bei dem Gespräch mit ziemlicher Farbe im Gesicht gut durchgehalten und so verliessen wir stolz das Rathaus. Und wirklich: Noch innerhalb der Frist erhielten wir die Mitteilung über die Zuweisung einer Wohnung auf der Hohen Strasse, nicht sehr weit von unserem Haus entfernt, sagen wir, in gut zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Das war sehr passabel. Da wir den Schlüssel noch nicht zur Verfügung hatten, bewegten wir uns zu dem bezeichneten Haus und suchten die entsprechend zugewiesen Wohnung auf. Und wirklich, durch den Briefschlitz und das Anheben des dahinter gehangenen Sichtschutzes aus Stoff konnten wir in die Wohnung etwas einsehen. Und sie sah nach unseren damaligen Begriffen zumindest akzeptabel aus, also freuten wir uns unbändig über den Erfolg und Sofie zog bei uns aus und in die neue Errungenschaft ein. Das Echo aus meinem Bekanntenkreis war zwiespältig. Wie kannst Du, meinte einer, in fast vierzehn Tagen eine Wohnung für Deine Tochter erhalten und ich versuche jahrelang nichts anderes und völlig aussichtslos für meinen Sohn. Ich war da hochnäsig. Aus meiner Sicht hatten wir sie uns redlich verdient. Ansichtssache. Eben. zum Anfang der Geschichte
|
||||||